PSA für Arbeiten unter Spannung
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Arbeiten unter Spannung sind lebensgefährlich. Als Elektrofachkraft sind Sie dabei der Gefahr einer Körperdurchströmung oder auftretenden Störlichtbögen ausgesetzt. Das ordnungsgemäße Tragen der richtigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) kann Ihr Leben retten.
Persönliche Schutzausrüstung: Unverzichtbar für die Elektrofachkraft
Wie in vielen andere Branchen und Berufsgruppen ist auch für Elektrofachkräfte das Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) unverzichtbar. Zum Glück bieten neue Materialien und Modelle mittlerweile neben einem hohen Maß an Elektrosicherheit auch einen angenehmen Tragekomfort.
Zu den spezifischen Gefährdungen, mit denen Sie bei Ihrer Arbeit als Elektrofachkraft konfrontiert werden, gehören elektrischer Schlag und Störlichtbögen, bei denen Temperaturen von mehreren 1.000 Grad Celsius entstehen können. Überall, wo Beschäftigte der Gefahr von Lichtbögen und Stichflammen durch Lichtbogenüberschlag ausgesetzt sind, ist flamm- und hitzebeständige Kleidung überlebenswichtig.
Dazu kommen an vielen Elektroarbeitsplätzen weitere Gefährdungen, die zusätzliche Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung stellen. Das kann beispielsweise der Schutz vor gefährlichen Chemikalien, Lärmschutz, Absturzsicherung oder Explosionsschutz sein. Auch beim Arbeiten unter Spannung (AuS) muss Ihre persönliche Schutzausrüstung besondere Kriterien erfüllen, damit Sie als Elektrofachkraft während der Arbeit ausreichend vor Gefährdungen geschützt sind.
Überlebenswichtig: PSA für Arbeiten unter Spannung
Bei Arbeiten unter Spannung berühren Personen bewusst mit Körperteilen, Ausrüstungen oder Vorrichtungen blanke oder Spannung stehende Teile oder die Elektrofachkraft dringt bei Hochspannung in die Gefahrenzone ein.
Arbeiten unter Spannung dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beteiligten gewährleistet ist. Daher müssen Sie als Elektrofachkraft bei Arbeiten unter Spannung immer eine angemessene persönliche Schutzausrüstung verwenden, die Sie vor Körperdurchströmung und vor Störlichtbögen schützt.
Im Elektrobereich wird neben der Bezeichnung „persönliche Schutzausrüstung“ oft auch der Begriff „Körperschutzmittel“ verwendet. Wichtige Vorgaben finden sich in den VDE-Bestimmungen für Körperschutzmittel, Schutzvorrichtungen und Geräte zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V (DIN VDE 0680 und VDE 0682). Für die Auswahl und die Anwendung der isolierenden Körperschutzmittel und Schutzvorrichtungen bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe gilt DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen".
Egal, ob Sie im Bereich der Stromversorgung oder bei der Bahn tätig sind; egal ob Sie Reparaturarbeiten oder Prüfungen durchführen; für Sie als Elektrofachkraft ist das Tragen der vorgeschriebenen PSA bei Arbeiten unter Spannung unverzichtbar.
NEU: Podcasts

elektrofachkraft.de zum Anhören
Isolierende Schutzkleidung
Die isolierende Schutzkleidung verhindert einen Stromübertritt von unter Spannung stehenden Teilen auf den menschlichen Körper. Daher ist besonders wichtig, dass immer alle Körperstellen bedeckt sind und dies auch bleiben.
Die PSA für Arbeiten unter Spannung besteht aus isolierenden Anzügen oder isolierenden Jacken, Hosen, Kopfbedeckung, Handschuhen und Stiefeln oder Überschuhen nach VDE 0682-301. Kurze oder hochgekrempelte Hosen und Arbeitsjacken sind selbstverständlich tabu.
Schutz vor Störlichtbögen
Damit Sie während der Arbeiten unter Spannung nicht nur vor Körperdurchströmung, sondern auch vor Störlichtbögen geschützt sind, muss Ihre Schutzkleidung hitzebeständig und schwer entflammbar sein. Wichtig ist ein Baumwollanteil der Kleidung von mindestens 35 Prozent.
Kopf, Hände und Unterarme sind am häufigsten von Verbrennungen durch Störlichtbögen betroffen. Denken Sie daher daran, die Ärmel Ihrer Jacke oder ihres Arbeitshemds nicht nach oben zu krempeln und stets auch Schutzhandschuhe zu tragen. Außerdem ist ein isolierender Schutzhelm mit Störlichtbogen-Visier als Kopf- und Gesichtsschutz wichtig bei Arbeiten unter Spannung oder bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V Wechselstrom oder 1.500 V Gleichstrom.
Tipp der Redaktion
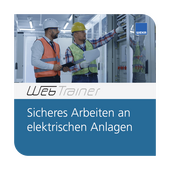
Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen
- E-Learning-Kurs für Fachkräfte der Elektrotechnik
- Mit Wissenstest und Teilnahmebestätigung
- Sorgen Sie für ein sicheres elektrotechnisches Arbeiten in Ihrem Betrieb.
Weitere Schutzelemente bei Arbeiten unter Spannung
Zusätzlich zur persönlichen Schutzausrüstung, die am Körper getragen wird, kann weitere Textil-Ausrüstung nötig sein. Isoliermatten bieten neben dem Personenschutz durch die Standortisolierung auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Sie werden z.B. in Hochspannungs-Schalträumen verwendet. Dazu kommen je nach Einsatzbereich weitere Schutzelemente wie Abdeckungen, Sperrkappen, Schutzhauben usw.
Persönliche Schutzausrüstung: Trageakzeptanz
In den letzten Jahren wurde der Tragekomfort der persönlichen Schutzausrüstung immer weiter optimiert. Das ist eine äußert positive Entwicklung, denn gerade die Trageakzeptanz von PSA ist ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit. Unfälle entstehen häufig dadurch, dass die persönliche Schutzausrüstung nicht oder nicht richtig getragen wird, obwohl sie vorhanden ist. Die Trageakzeptanz ist eine Gratwanderung zwischen der erforderlichen Schutzfunktion und der zusätzlichen Belastung für den Träger. Durch zusätzliches Gewicht, eingeschränkte Beweglichkeit und verminderter Tast-, Seh- oder Hörsinn wird der Träger eingeschränkt und die Arbeit erschwert.
Doch Unbequemlichkeit gilt nicht mehr als Ausrede. Das Ziel aller neuen Entwicklungen ist, dass die Schutzkleidung den Träger so wenig wie möglich behindert. Arbeitsabläufe und Bewegungen sollen möglichst wenig eingeschränkt werden bei gleichzeitig hochgradigen Schutzfunktionen. Die PSA wird immer leichter und wirkt sportlicher. Helme oder Handschuhe, Jacken oder Brillen sehen immer attraktiver aus und sind angenehmer zu tragen. Es gibt endgültig keine „Entschuldigung“ mehr, notwendige Schutzausrüstungen nicht zu tragen.
Weiterentwicklung der PSA
Neue Materialien für Jacken und Hosen aus organischen Kunstfasern (Aramid-Fasern) bieten nicht nur Flammschutz, sondern auch Beständigkeit gegen Chemikalien. Sollte ein Lichtbogen auftreten, absorbiert das Material die freigesetzte Strahlungs- und Hitzeenergie. Schlimme Verbrennungen und Verletzungen werden verhindert.
Hochwertige Elektrikerhandschuhe z.B. können für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1.000 V geeignet sein, gleichzeitig beständig gegen Öl oder Säuren und auch noch vor Kälte schützen. Dennoch sind sie flexibel und schränken das Tastempfinden nicht allzu sehr ein. In Elektrowerkstätten und bei Reparaturarbeiten im Spannungsbereich sind sie unverzichtbar.
Neuere Modelle der isolierenden Schutzhelme bieten mit umlaufendem Schweißband, Kinnschutz und Anti-Beschlag-Beschichtung einen hohen Tragekomfort.
Downloadtipps der Redaktion
Formular: Bestellung zur Elektrofachkraft
Hier gelangen Sie zum Download.
Arbeitsauftrag: AuS nach VDE 0105-100
Hier gelangen Sie zum Download.
e+-Artikel: Kriterien für einen effizienten Störlichtbogenschutz in Niederspannungs-Schaltanlagen
Hier gelangen Sie zum Download.
Unterweisung: VDE 0100-410 Schutz gegen elektrischen Schlag
So muss PSA für Elektrofachkräfte gekennzeichnet sein
In der DIN EN 340 werden die notwendigen Eigenschaften von Schutzkleidung festgelegt. Dabei geht es nicht nur um die Anforderungen an die Ergonomie und das Alterungsverhalten, sondern auch um die Kennzeichnung der PSA und notwendige Herstellerangaben.
Die isolierende Schutzausrüstung für die Elektrofachkraft muss folgendermaßen gekennzeichnet sein:
- Herkunftszeichen (Name oder Markenzeichen) des Herstellers
- Jahr der Herstellung
- VDE-Prüfzeichen
- CE-Kennzeichen
- bei Schutzanzügen: Kennzeichnungsfeld für wiederkehrende Prüfungen:
- bei Jacken: am unteren Saum, innen
- bei Hosen: im Bund
- beim Kopfschutz: am unteren Rand, hinten
Selbstverständlich finden Sie an Schutzkleidung auch die Größenangabe sowie Angaben zu Waschen und Textilpflege.
Vorsicht: PSA darf nicht leichtsinnig machen!
Der Mensch hat ein ambivalentes Verhältnis zur Sicherheit. Wir neigen dazu, uns freiwillig und gern einem gewissen Risikograd auszusetzen. Menschen suchen die Gefahr, sie stürzen sich freiwillig Skisprungschanzen hinunter oder an Bungee-Seilen von hohen Brücken. Wir verlassen uns dabei auf Sicherheitsmaßnahmen und Schutzausrüstungen, ohne die solche Wagnisse Selbstmord wären.
Diese „Lust auf Risiko“ ist am Arbeitsplatz tabu. Denn wer sich als Elektrofachkraft oder Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nicht ausreichend schützt, spielt mit seiner Gesundheit und seinem Leben.
Dazu kommt die sogenannte Risikokompensation. Verkehrs- und Arbeitspsychologen sprechen vorn den „Rebound-Effekten“ (engl. rebound = zurückprallen). Gemeint ist das paradox klingende Phänomen, dass Maßnahmen für mehr Sicherheit das Gegenteil von dem bewirken können, was sie erreichen wollen. Beispielsweise schnallen sich Fahrer von schweren Geländewägen weniger an oder Autofahrer sitzen länger am Steuer, wenn ein Müdigkeitssensor aktiv ist.
Verantwortliche Elektrofachkräfte mit Führungsaufgaben sollten diese Aspekte kennen. Es ist immer darauf zu achten, dass das Befolgen von festgelegten Schutzmaßnahmen nicht zu einem sorgloseren Umgang mit der Gefahr führt. Machen Sie sich (und Ihren Mitarbeitern in Sicherheitsunterweisungen) bewusst, was nur auf den ersten Blick banal klingt: Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung macht das Auftreten eines Lichtbogens oder einen anderen Unfall nicht unwahrscheinlicher. Die Verwendung von Schutzausrüstung ist richtig und notwendig, doch sie darf niemals dazu verleiten, in Sachen Elektrosicherheit sorgloser zu agieren.



















Kommentare
Einen Kommentar schreiben