Normgerecht gegen Oberschwingungen: Was sich in der Elektrotechnik bewegt
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Oberschwingungen in elektrischen Netzen stellen eine wachsende Herausforderung für die Betriebssicherheit und Energieeffizienz dar. Neue europäische Normen und verschärfte gesetzliche Vorgaben verlangen von Betreibern und Elektrofachkräften, die Netzqualität aktiv zu überwachen und gezielt Maßnahmen zur Reduzierung von Oberschwingungen zu ergreifen. Moderne Filtertechnologien, präzise Netzanalyse und eine lückenlose Dokumentation sind dabei ebenso gefragt wie das Verständnis für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Technik, Recht und Wirtschaftlichkeit.
Oberschwingungen in elektrischen Netzen entstehen durch das Verhalten nicht linearer Verbraucher. Typisch sind Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, LED-Beleuchtungen oder USV-Anlagen. Diese Geräte arbeiten mit hohen Schaltfrequenzen und entnehmen dem Netz keinen sinusförmigen Strom. Das führt zu Verzerrungen, die als Total Harmonic Distortion (THD) gemessen werden. Ein hoher THD-Wert belastet Kabel und Schaltanlagen, verursacht zusätzliche Verluste in Transformatoren und Kondensatoren und führt zu Überhitzungen in Motoren. Resonanzerscheinungen können die Netzstabilität weiter gefährden. In Rechenzentren, Krankenhäusern oder Industrieanlagen mit empfindlicher Elektronik kann dies zu Fehlfunktionen oder Ausfällen führen. Natürlich sind auch alle anderen elektrischen Anlagen generell gefährdet.
Normative Vorgaben in Europa
Die Spannungsqualität wird durch DIN EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“ geregelt. Mit der Ausgabe 2022 und dem Änderungsentwurf A1 von 2025 sind die Grenzwerte für Oberschwingungen erstmals verbindlich. Damit müssen Netzbetreiber die Spannungsqualität an Anschlusspunkten nachweisen und sicherstellen, dass die zulässigen Verzerrungen nicht überschritten werden. Ergänzend greifen die Normen der IEC-61000-Reihe „Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)“. EN IEC 61000-3-2 „Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 3-2: Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom = 16 A je Leiter)“ mit Amendment 2 aus 2024 präzisiert Grenzwerte für Geräte bis 16 Ampere. EN IEC 61000-3-12 „Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 3-12: Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind“ mit Amendment 1 aus 2024 betrifft Geräte bis 75 Ampere. Für industrielle Umgebungen gilt EN 61000-2-4 „Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Umgebungsbedingungen – Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen in Industrieanlagen“, die 2024 neu gefasst wurde. Sie definiert Kompatibilitätspegel bis 150 Kilohertz und berücksichtigt damit auch Supraharmonische. Neu eingeführt wurde die partielle gewichtete Oberschwingungsverzerrung (PWHD), die eine differenziertere Bewertung erlaubt. Für Messmethoden ist EN 61000-4-30 „Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren – Verfahren zur Messung der Spannungsqualität“ maßgeblich. Diese Norm legt Genauigkeitsklassen und Verfahren für Netzqualitätsanalysatoren fest.
EU-Richtlinien und Rechtsrahmen
Die EMV-Richtlinie 2014/30/EU bildet zusammen mit dem EMV-Gesetz den verbindlichen Rahmen für die elektromagnetische Verträglichkeit. Sie gilt für Geräte, ortsfeste Anlagen und bewegliche Anlagen. Elektrofachkräfte müssen sicherstellen, dass jede Anlage normgerecht geplant, installiert und dokumentiert ist. Harmonisierte Normen gelten als Nachweis der Konformität. Parallel gilt die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, die durch die Richtlinie (EU) 2024/2749 ergänzt wurde. Die EMV-Richtlinie bleibt der zentrale Rechtsrahmen für Störaussendung und Störfestigkeit, wurde jedoch zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2749 ergänzt. Ab dem 30.05.2026 gilt ein Notfallmodus, der in Krisensituationen beschleunigte Konformitätsbewertungen ermöglicht, ohne die grundlegenden Sicherheitsanforderungen aufzuweichen.
Tipp der Redaktion
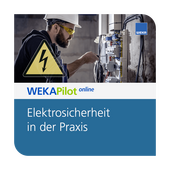
Das Nachschlagewerk für die Elektrofachkraft
Organisation, Durchführung und Dokumentation elektrotechnischer Prüfungen – „Elektrosicherheit in der Praxis“ unterstützt Sie bei der Umsetzung der Elektrosicherheit in Ihrem Unternehmen.
Parallel wird die Liste harmonisierter Normen fortlaufend aktualisiert. Ältere Standards wie EN 55103-2 „Elektromagnetische Verträglichkeit – Produktfamiliennorm für Audio-, Video- und audiovisuelle Einrichtungen sowie für Studio-Lichtsteuereinrichtungen für professionellen Einsatz
Teil 2: Störfestigkeit“ wurden gestrichen und durch EN 55035 „Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten – Anforderungen zur Störfestigkeit“ ersetzt, auch bei Installationsverteilern, Flurförderzeugen und Schützen greifen neue EN- und IEC-Normen. Technisch verschiebt sich der Fokus zunehmend auf Supraharmonische bis 150 Kilohertz, die über die IEC-61000-Reihe in die EMV-Bewertung einbezogen werden. Mit der Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020 wurde zudem die Kontrolle verschärft. Behörden wie die Bundesnetzagentur können stichprobenartig Anlagen prüfen und bei Verstößen Nachbesserungen oder Stilllegungen anordnen.
Zusammenspiel mit weiteren EU-Richtlinien
Oberschwingungen und Netzqualität stehen nicht isoliert im Rechtsrahmen, sondern sind mit anderen europäischen Vorschriften eng verbunden. Die Maschinenrichtlinie bzw. ab 2027 die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 verlangen den Nachweis, dass eingesetzte elektrische Komponenten keine unzulässigen elektromagnetischen Störungen erzeugen. Die Maschinenverordnung wurde nach ihrer Veröffentlichung am 29.06.2023 korrigiert. Ein Corrigendum vom 04.07.2023 verschob mehrere Fristen leicht, etwa den Geltungsbeginn auf den 20.07.2024 (statt ursprünglich 14. Juli) sowie das Auslaufen der bisherigen Maschinenrichtlinie auf den 20.01.2027.
Zudem verstärkte die Verordnung mit dem durch die Verordnung (EU) 2024/2748 vom 08.11.2024 eingeführten Binnenmarkt‑Notfallregime die Möglichkeit, Notfall‑Konformitätsbewertungen zu beschleunigen, relevant auch bei Krisenlagen, in denen Netzkomponenten mit Oberschwingungsrisiken schnell zugelassen werden müssen.
Ähnliches gilt für die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, die für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen eine besonders strenge Kontrolle der elektrischen Betriebsmittel vorsieht, einschließlich deren elektromagnetischer Eigenschaften. Auch die Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU verweist bei elektrischen Steuerungen und Antrieben auf die Einhaltung der EMV-Anforderungen. Die Aufzugsrichtlinie selbst wurde bislang nicht geändert, befindet sich jedoch in einer laufenden Evaluierung durch die EU-Kommission. Neu ist ein im Januar 2025 veröffentlichter Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie, der Betreibern und Herstellern praxisnahe Auslegungshilfen bietet. Zudem wurden mehrere harmonisierte Normen aktualisiert, darunter EN 81-28 „Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Aufzüge für den Personen- und Gütertransport – Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenaufzüge“ für Notrufsysteme, EN 81-58 „Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Überprüfung und Prüfverfahren – Teil 58: Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren“ zum Feuerwiderstand von Fahrschachttüren und EN 81-71 „Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge – Teil 71: Schutzmaßnahmen gegen mutwillige Zerstörung“ zum Schutz gegen Vandalismus. Auch Teile der EN 81-41 „Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Spezielle Aufzüge für den Personen- und Gütertransport – Teil 41: Vertikale Plattformaufzüge für Personen mit eingeschränkter Mobilität“ für Plattformaufzüge wurden überarbeitet. Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend auf sicherheitstechnische Detailanforderungen, ohne dass der Rechtsrahmen selbst angepasst wurde.
Übergeordnet sorgt die Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020 dafür, dass die Einhaltung dieser Vorgaben in allen Mitgliedstaaten überwacht wird. Schließlich legt die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zur europäischen Normung fest, wie harmonisierte Normen wie DIN EN 50160 oder IEC 61000 offiziell in Kraft gesetzt werden. Damit wird deutlich, dass die Reduzierung von Oberschwingungen nicht nur eine technische Maßnahme ist, sondern integraler Bestandteil eines komplexen europäischen Regelwerks, das mehrere Richtlinien und Verordnungen miteinander verzahnt.
Downloadtipps der Redaktion
E-Book: Industrie 4.0 in der Anwendung
Hier gelangen Sie zum Download.
Formular: Bestellung zur Elektrofachkraft
Hier gelangen Sie zum Download.
Checkliste: Funktionale Aspekte – Energieeffizienz
Hier gelangen Sie zum Download.
Checkliste: Energiemanagementsystem nach DIN VDE 0100-801
Netzbetreiber und europäische Network Codes
Neben den Normen spielen die europäischen Network Codes eine wichtige Rolle. Sie verpflichten Betreiber und Netzbetreiber, technische Mindestanforderungen zur Systemstabilität einzuhalten. Dazu gehören auch Vorgaben zur Oberschwingungsbelastung an Netzanschlusspunkten. In Deutschland legen Netzbetreiber auf dieser Basis Planungspegel fest. Diese Werte sind Bestandteil der Netzanschlussverträge und müssen von Betreibern eingehalten werden. Elektrofachkräfte müssen diese Anforderungen schon in der Planungsphase berücksichtigen, um teure Nachrüstungen zu vermeiden.
Praktische Bedeutung der Netzanalyse
Eine Netzanalyse erfasst alle relevanten Parameter zur Beurteilung der Netzqualität. Dazu gehören Spannung, Strom, Frequenz, Oberschwingungen, Flicker und Unsymmetrien. Netzqualitätsanalysatoren nach EN 61000-4-30 „Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-30: Prüf- und Messverfahren – Verfahren zur Messung der Spannungsqualität“ der Klasse A liefern präzise Ergebnisse. Gemessen werden kann temporär zur Fehlersuche oder dauerhaft zur Überwachung. Typische Grenzwerte verdeutlichen den Handlungsbedarf: In Niederspannungsnetzen darf die THD der Spannung nach EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“ acht Prozent nicht überschreiten. In der Praxis werden diese Werte in modernen Netzen oft unterschritten, doch in Industrieanlagen mit hoher Leistungselektronik sind Überschreitungen nicht selten.
Technologien zur Reduzierung von Oberschwingungen
Zur Begrenzung von Oberschwingungen stehen verschiedene Technologien zur Verfügung. Passive Filter wie Drosseln oder LC-Filter können Verzerrungen mindern, sind jedoch in ihrer Wirksamkeit begrenzt. Effektiver sind aktive Systeme. Active-Front-End-Frequenzumrichter mit IGBT-Gleichrichtern regeln den Stromfluss so präzise, dass nahezu sinusförmige Ströme entstehen. In Kombination mit LCL-Filtern sinken die THD-Werte auf etwa drei Prozent.
Konventionelle Umrichter mit Netzdrosseln erreichen dagegen bis zu 40 Prozent. Parallel eingesetzte aktive Oberschwingungsfilter kompensieren gezielt störende Frequenzen und eignen sich für die Nachrüstung. Systeme wie die Ultra-Low Harmonic Drives von ABB reduzieren Oberschwingungen und kompensieren Blindleistung. Damit lassen sich Überdimensionierungen von Kabeln und Transformatoren vermeiden und zusätzliche Kosten durch Blindleistungsbezug senken.
Technische Strategien zur Netzstabilisierung
Neben Filtern und frequenzgeregelten Antrieben gibt es weitere technische Ansätze, um die Auswirkungen von Oberschwingungen zu begrenzen. Netzseitig können Dämpfungsmaßnahmen durch den gezielten Einsatz von Drosseln, Kompensationsanlagen oder Transformatoren mit K-Faktor erfolgen, die speziell für Oberschwingungsströme ausgelegt sind.
In Mittel- und Hochspannungsnetzen kommen zunehmend sogenannte Hybridfilter zum Einsatz, die passive und aktive Elemente kombinieren und so in einem breiten Frequenzbereich wirksam sind. Eine besondere Rolle spielt die Integration von Energiespeichern, die Lastspitzen glätten und das Netzverhalten stabilisieren können. Moderne Mess- und Steuerungstechnik ermöglicht es zudem, Oberschwingungen in Echtzeit zu überwachen und durch adaptive Regelungen dynamisch gegenzusteuern. Diese Verfahren gewinnen an Bedeutung, da die zunehmende Einspeisung dezentraler Erzeugungsanlagen und die steigende Zahl leistungselektronischer Verbraucher die Netzstruktur komplexer und anfälliger für harmonische Verzerrungen machen.
Tipp der Redaktion

Elektrowissen zum Mitnehmen
- Lesen Sie spannende Expertenbeiträge.
- Stellen Sie unseren Fachexperten Ihre Fragen.
- Nutzen Sie die Download-Flat mit einer Vielzahl an Checklisten, Prüflisten, Arbeits- und Betriebsanweisungen.
Auch als Onlineversion erhältlich. Machen Sie mit beim Papiersparen.
Verantwortung der Elektrofachkräfte
Die Aufgabe der Elektrofachkraft reicht von der Auswahl geeigneter Geräte über die normgerechte Planung bis hin zur Dokumentation. Bei neuen Projekten muss eine Prognose über die zu erwartenden Oberschwingungen erstellt werden. In Bestandsanlagen sind Netzanalysegeräte einzusetzen, um Grenzwerte kontinuierlich zu überwachen. Abweichungen müssen dokumentiert und mit geeigneten Maßnahmen behoben werden. Nachrüstungen mit Filtern oder AFE-Umrichtern sind dabei gängige Lösungen. Jede Anlage unterliegt zudem den Dokumentationspflichten der EMV-Richtlinie. Schaltpläne, Prüfberichte und Nachweise harmonisierter Normen sind vorzuhalten, um bei Kontrollen durch die Bundesnetzagentur den Nachweis der Konformität führen zu können.
Regelmäßige Prüfungen und die korrekte Dokumentation sind ein weiterer Schwerpunkt bei der Reduzierung von Oberschwingungen. Nach DIN VDE 0100-600 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 6: Prüfungen“ und DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 100: Allgemeine Festlegungen“ sind elektrische Anlagen nicht nur bei der Erstinbetriebnahme, sondern auch nach Änderungen und in wiederkehrenden Intervallen auf ihre Sicherheit zu prüfen. Für Elektrofachkräfte bedeutet das, auch die Netzqualität und Oberschwingungswerte in diese Prüfungen einzubeziehen und die Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren. CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung müssen alle zutreffenden Richtlinien berücksichtigen, nicht nur die EMV- und Niederspannungsrichtlinie, sondern auch Maschinen- oder Funkanlagenrichtlinie, sofern entsprechende Komponenten integriert sind. Die Bundesnetzagentur ist befugt, stichprobenartige Kontrollen durchzuführen und bei Verstößen Maßnahmen wie Nachbesserung oder Stilllegung anzuordnen. Eine lückenlose Dokumentation aller EMV-relevanten Nachweise, Prüfprotokolle und Schaltpläne ist daher nicht nur gute Praxis, sondern Pflicht.
Wirtschaftliche und betriebliche Auswirkungen von Oberschwingungen
Über die technischen Risiken hinaus haben Oberschwingungen unmittelbare Folgen für den wirtschaftlichen Betrieb elektrischer Anlagen. Höhere Verlustleistungen in Kabeln, Motoren und Transformatoren steigern den Energieverbrauch, was sich in den Betriebskosten niederschlägt. Netzbetreiber erheben zudem Entgelte, wenn vereinbarte Qualitätsparameter überschritten oder Blindleistungsgrenzen nicht eingehalten werden. Unternehmen riskieren Vertragsstrafen oder Auflagen, wenn sie Oberschwingungen in unzulässigem Maß in das Netz einspeisen. Hinzu kommt die indirekte Kostenbelastung durch Ausfälle und verkürzte Lebensdauer elektrischer Betriebsmittel, die sich in der Bilanz oft erst zeitverzögert zeigt. Für Betreiber rechnet sich daher eine frühzeitige Investition in aktive Filtertechnik oder netzfreundliche Antriebe nicht nur aus technischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht.
Verbindung zu Ökodesign und Green Deal
Die europäische Energie- und Klimapolitik bezieht die Netzqualität zunehmend in übergeordnete Ziele ein. Mit der geplanten neuen Ökodesign-Verordnung sollen nicht nur Effizienzwerte, sondern auch Netzrückwirkungen stärker berücksichtigt werden. Gerätehersteller müssen in Zukunft nachweisen, dass ihre Produkte nicht nur wenig Energie verbrauchen, sondern auch die Stromnetze nicht übermäßig durch Oberschwingungen oder Blindleistung belasten.
Bei der Ökodesign- und ErP‑Regulierung wurden neuste Entwicklungen sichtbar. Die EU plant neue Durchführungsmaßnahmen für diverse Produktgruppen, darunter Leistungstransformatoren, Elektromotoren, USV-Systeme oder smarte Netzgeräte, um künftig nicht nur Energieeffizienz, sondern auch Netzverträglichkeit zu prüfen.
Die bisher geltende Ökodesign-Verordnung (EU) Nr. 548/2014 für Transformatoren wurde zuletzt am 01.10.2019 aktualisiert und bleibt trotz der neuen Verordnung (EU) 2024/1781 vorerst gültig, da diese Produktgruppe bislang nicht in den neuen Rahmen einbezogen wurde.
Ergänzend fordert der Green Deal, dass Stromnetze resilienter und sauberer werden, was die Reduzierung von Oberschwingungen ausdrücklich einschließt. Für Betreiber bedeutet das, dass Investitionen in netzfreundliche Technik nicht nur eine Frage der Betriebssicherheit, sondern auch ein Beitrag zur Erfüllung europäischer Klimaziele sind. Damit rückt die Minimierung von Oberschwingungen in den größeren Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit.
Fazit
Die Reduktion von Oberschwingungen ist eine verbindliche Anforderung des europäischen Rechtsrahmens und kein optionales Optimierungsziel. Mit der Verschärfung von EN 50160, den aktualisierten Normen EN IEC 61000 und den europäischen Network Codes sind die Grenzen enger gesteckt. Elektrofachkräfte tragen die Verantwortung, Oberschwingungen systematisch zu erfassen, zu bewerten und zu reduzieren. Moderne Antriebstechnik, aktive Filter und präzise Netzanalysegeräte sind dafür unverzichtbare Werkzeuge. Nur durch die konsequente Umsetzung dieser Vorgaben lassen sich Netzqualität, Betriebssicherheit und rechtliche Konformität langfristig sicherstellen.
Weitere Beiträge zum Thema
Probleme mit Oberschwingungen – Teil 1
Probleme mit Oberschwingungen – Teil 2
Gebäudeautomation: Netzwerke und Protokolle
Regelungstechnik – die Basis für die Gebäudeautomation
Gebäudeautomation: Herausforderung für die Elektrofachkraft
GEG – das Gebäudeenergiegesetz
DIN VDE 0105-100 – Sicherer Betrieb elektrischer Anlagen
Den Energieverbrauch nachhaltig senken: das Energieeffizienzgesetz (EnEfG)




















Kommentare
Einen Kommentar schreiben