Keine Wärmewende ohne Wärmespeicherung
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Die Wärmewende ist ein unverzichtbarer Teil der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewende. Da rund die Hälfte des deutschen Energieverbrauchs auf Raum- und Prozesswärme sowie Warmwasser fällt, bietet eine optimierte Wärmeversorgung großes Potenzial für Effizienz und Klimaschutz. Im Fokus stehen dabei Wärmenetze, die erneuerbare Energiequellen und industrielle Abwärme nutzen – statt fossiler Brennstoffe. Doch eine zentrale Frage bleibt: Wie lässt sich überschüssige Wärme sinnvoll für eine spätere Nutzung zwischenspeichern?
Das Konzept der Energiewende beruht auf der vorrangigen Nutzung erneuerbarer Energien. Weil Strom u.a. in Photovoltaik- oder Windkraftanlagen volatil – also nicht planbar und nicht konstant – erzeugt wird, müssen Erzeugung und Verbrauch zeitlich entkoppelt werden.
Wärmespeicher können das für die thermische Energie erreichen. Wird überschüssige Wärme in die Umwelt abgegeben, ist das ineffizient und u.a. für Flüsse, Pflanzen und Tiere schädlich. Das gilt unabhängig davon, ob thermische Energie zur Heizung und Warmwasserbereitung oder für industrielle Prozesse benötigt wird und ob ein Mehrfamilienhaus oder ein Industriepark versorgt werden muss.
Der Faktor Zeit wird in der Wärmespeicherung künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen. Heute halten wassergespeiste Pufferspeicher in Heizungsanlagen Wärme stunden- und sogar tagelang. In Zukunft werden Wärmespeicher gefragt sein, die eine Speicherdauer von mehreren Tagen bis hin zu Monaten möglich machen. Sie werden gebraucht, weil fossile Wärmequellen in Wärmenetzen zunehmend durch klimafreundliche, aber fluktuierende Quellen ersetzt werden und weil industrielle Abwärme genutzt werden muss.
Anwendungsbereiche von Wärmespeichern
Grundsätzlich werden Wärmespeicher künftig für zwei große Anwendungsbereiche benötigt:
- Speicherung für industrielle Prozesse: Typisch sind Hochtemperaturprozesse mit Anwendungen im Bereich solarthermischer Stromerzeugung und Prozessenergie. Hier erreicht die Speichertemperatur bis zu über 500 °C. Mitteltemperaturspeicher sind für Temperaturen zwischen 100 und 500 °C ausgelegt.
- Speicherung für Brauchwasser, Raumwärme, Kühlung und Klimatisierung: Hier dominiert der Niedertemperaturbereich mit Temperaturen bis zu 100 °C.
Nicht alle Wärmespeichersysteme, an denen heute geforscht wird, sind bereits marktfähig. Allerdings ist in den kommenden Jahren mit Innovationen zu rechnen.
Downloadtipps der Redaktion
E-Book: Photovoltaikanlagen normkonform errichten
Hier gelangen Sie zum Download.
E-Book: Elektrosicherheit in der Elektromobilität
Hier gelangen Sie zum Download.
Downloadpaket für ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel
Hier gelangen Sie zum Download.
Checkliste: Funktionale Aspekte – Energieeffizienz
Die wichtigsten Wärmespeichersysteme
Wie hoch der künftige Stellenwert von Wärmespeichern für die Energiewende von der Bundesregierung eingeschätzt wird, belegen u.a. die zahlreichen Fördermöglichkeiten. Die Anschaffung und Installation eines Wärmespeichers werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bezuschusst.
Herkömmliche Wärmespeicher wie die schon lange eingesetzten Warmwasserspeicher basieren auf der direkten Speicherung thermischer Energie durch die Erhöhung der Temperatur im Speichermaterial. Indirekte Wärmespeicher dagegen erhalten die vom Speicher verrichtete Arbeit. Entscheidend für alle Typen von Wärmespeichern ist, dass die gespeicherte thermische Energie zu einem gewünschten Zeitpunkt wieder abgegeben wird. Entsprechend der Dauer der Speicherung unterscheidet man u.a. Puffer-, Kurzzeit- und Langzeitspeicher.
Außerdem lassen sich Wärmespeichersysteme nach dem physikalischen Grundprinzip typologisieren:
Sensible Wärmespeicher
Diese Systeme speichern thermische Energie über Temperaturänderungen in flüssigen oder festen Medien wie Beton, Wasser oder Erde. Aufgeladen wird das Speichermedium durch die Zufuhr von Wärme. Wird Energie entnommen („Entladen“), sinkt die Temperatur im Speichermedium ab.
Sensible Wärmespeicher sind am Markt leicht verfügbar, aber weniger effizient als Speicher auf der Basis neuer Technologien. Dennoch prognostizieren Experten gerade den wassergestützten Wärmespeichern trotz ihrer beschränkten Effizienz eine große Zukunft: Wasser ist leicht verfügbar, hat keine toxischen oder umweltgefährdenden Eigenschaften und ist unkompliziert zu entsorgen.
Für Temperaturbereiche über 150 °C nutzt man bei sensiblen Wärmespeichern statt Wasser auch Aluminiumoxid, Salz, Sand oder Betonspeicher als Speichermedien.
Latente Wärmespeicher
Diese Wärmespeicher arbeiten mit Speichermedien (Phasenwechselmaterial, englisch: Phase Change Material, PCM), die ihren Aggregatzustand verändern, wenn Energie zugeführt wird. Durch den Phasenwechsel (von fest zu flüssig) des Speichermediums (u.a. Paraffin, Eis, Salzhydrate) können große Energiemengen gespeichert werden. Die Temperatur des Speichermaterials aber wird kaum verändert. Die zugeführte Energie wird als latente, also verborgene Wärme gespeichert. Um sie wieder freizusetzen, benötigt man einen Auslöser.
Die Latentwärmespeicherung ist eine vergleichsweise junge Technologie. Die Energiedichte ist etwa dreimal so hoch wie bei sensiblen Wärmespeichern. Latentwärmespeicher haben bei gleicher Masse mehr Kapazität als andere Speichertypen. Aktuell wird mit unterschiedlichsten Stoffen für die Speicherung und mit einem breiten Temperaturspektrum geforscht, u.a. mit
- Salzschmelzen für Hochtemperatureinsatz über 150 °C
- Natrium-Acetat bei 58,5 °C
- Phase-Change-Slurries (Flüssigkeitsgemische, die als Wärmespeichermedium eingesetzt werden) im Bereich von 0 °C bis 50 °C
- Lithium-, Kalium- und Natriumnitrat und deren Mischungen für Temperaturbereiche zwischen 130 und 330 °C
Tipp der Redaktion

Sie wollen mehr Infos zu diesem und weiteren Themen?
Dann empfehlen wir Ihnen elektrofachkraft.de – Das Magazin:
- spannende Expertenbeiträge zu aktuellen Themen
- Download-Flat mit Prüflisten, Checklisten, Arbeits- und Betriebsanweisungen.
Auch als Onlineversion erhältlich. Machen Sie mit beim Papiersparen.
Aktuell stehen im Wesentlichen drei Arten von Latentwärmespeichern zur Verfügung:
- Eisspeicher
Eisspeicher werden meist unter der Erdoberfläche gebaut. Sie bestehen aus einer nicht isolierten Betonzisterne, in der Spiralleitungen verlaufen, die mit einer frostsicheren Flüssigkeit (Sole) gefüllt sind. Meist nutzt man zwei Spiralsysteme: einen Entzugswärmetauscher und einen Regenerationswärmetauscher. Als Speichermaterial dient Wasser. Eisspeicher werden häufig mit einer Wärmepumpe und einer Solarthermieanlage kombiniert. Zu einem solchen System gehört außerdem ein Warmwasserspeicher. Im Sommer kann überschüssige Energie auf niedrigem Temperaturniveau gespeichert werden. Im Winter nutzt die Wärmepumpe die gespeicherte Wärme für Warmwasserbereitung oder Heizung. - Paraffinwärmespeicher
Auch Paraffinwärmespeicher können mit einer Solarthermieanlage kombiniert werden. Effizient sind sie, weil ihre Speicherkapazität fünfmal so hoch ist wie bei herkömmlichen Wärmespeichern. Außerdem benötigen sie lediglich ein Drittel des Platzes. Die Schmelztemperatur von Paraffin liegt im Bereich von 60 °C, wodurch es für viele Anwendungen gut geeignet ist. - Thermobatterien mit Salz
Als Wärmespeichermedium wird hier Natriumacetat, das Natriumsalz der Essigsäure, genutzt. Das System basiert auf dem Phasenwechsel von festem Natriumacetat zum flüssigen Zustand bei etwa 60 °C.
Thermochemische Wärmespeicher
Auf diesen Speichertyp setzen Experten große Hoffnungen, obwohl er noch wenig etabliert ist. Bei thermochemischen Speichern wird Wärme durch eine chemische Reaktion gespeichert und, sobald sie gebraucht wird, wieder freigesetzt. Man nutzt also eine reversible chemische Reaktion für die Wärmespeicherung. Die Energiedichte von thermochemischen Speichern ist bis zu fünfmal höher als bei sensiblen Speichern. Außerdem kann Energie nahezu verlustfrei über lange Zeiträume gespeichert werden.
Wärmespeicher, die den physikalischen Effekt der Adsorption nutzen, arbeiten mit festen Speichermedien wie Zeolith in Form von kleinen Kristallen mit einer porösen Oberfläche. Unter Adsorption versteht man die Anlagerung von Teilchen einer benachbarten flüssigen oder gasförmigen Phase an der Oberfläche eines Festkörpers. Weil Adsorption keine chemische Reaktion, sondern ein physikalischer Vorgang ist, sind diese Speicher zwar streng genommen keine thermochemischen Speicher, werden aber meist zu ihnen gerechnet.
Derzeit werden sehr viele unterschiedliche Speichermaterialien erforscht, etwa Natronlauge. Ausgangspunkt dabei ist ein Tank, der mit Natronlauge gefüllt ist. Wird diesem Wasser beigegeben, entsteht Wärme. Erhitzt man das verdünnte Gemisch wieder, verdampft das Wasser, und es bleibt nur die Natronlauge zurück. Gibt man dieser wiederum Wasser bei, startet der Prozess erneut.
Thermochemische Speicher in der Forschung
An der Technischen Universität Wien haben Forscher einen Speichertyp entwickelt, bei dem feste Borsäure mit Öl vermischt und in einen Reaktor gefüllt wird. Dessen Wand wird auf eine Temperatur zwischen 70 und 200 °C aufgeheizt. Dadurch kommt es zu einer chemischen Reaktion, bei der die Borsäure in Boroxid umgewandelt wird. Das entstehende Wasser wird dem Reaktionsgemisch entzogen, sodass nur eine energiereiche, ölige Boroxid-Suspension zurückbleibt, die sich problemlos in Tanks lagern lässt. Gibt man der Suspension erneut Wasser zu, läuft die chemische Reaktion in umgekehrter Reihenfolge ab. Der Vorteil dieser Technologie: Boroxidspeicher können auf industrielle Maßstäbe skaliert werden. Weil der Temperaturbereich für zahlreiche industrielle Prozesse ohnehin bei 70 bis 200 °C liegt, kann hier Abwärme genutzt werden.
Nach derzeitigem Forschungsstand sind thermochemische Speicher noch nicht vollständig ausgereift: Noch ist die Technologie teuer und die Wärmeleistung eher gering. Allerdings wird sehr, sehr intensiv an der Optimierung thermochemischer Speicher geforscht.
Tipp der Redaktion
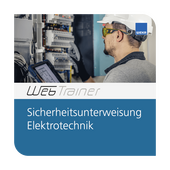
Sicherheitsunterweisung Elektrotechnik
- Erst- und Wiederholungsunterweisung für Elektrofachkräfte
- Modern und ohne Aufwand schulen
- Für die Elektrosicherheit in Ihrem Betrieb nach DGUV- und VDE-Vorschriften
Kennzahlen von Wärmespeichern
Um die Leistung eines Wärmespeichers zu bewerten, vergleicht man u.a. diese Kennzahlen:
- Energiedichte
Diese Kennzahl gibt an, wie viel Wärmeenergie ein Wärmespeicher aufnehmen kann. Meist wird die Energiedichte als Verhältnis von Kilowattstunden zu Volumen (kWh/m³) angegeben. - Nutzungsgrad
Jeder Wärmespeicher verliert mit der Zeit an Wärmeenergie. Der Nutzungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen der verwendbaren und der zugeführten Wärmeenergie. Je höher der Nutzungsgrad ausfällt, desto höher ist auch die Speichereffizienz und desto geringer sind die Energieverluste. - Belade- und Entladezeit
Die Zeit, die ein Wärmespeicher zum Be- und Entladen benötigt, ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Die Aufladezeit gibt an, wie lange ein Wärmespeicher zur kompletten Aufladung benötigt. Die Entladezeit besagt, wie schnell er sich entlädt. - Temperatur
Damit wird angegeben, wie hoch die Temperatur in einem Wärmespeicher maximal werden kann. Die jeweils erforderliche Temperatur hängt vom geplanten Zweck des Speichers ab. - Speicherzyklen
Bei jedem Auf- und Entladen verliert ein Wärmespeicher an Kapazität. Die Zahl der möglichen Speicherzyklen zeigt an, wie lange der Wärmespeicher genutzt werden kann, ohne dass sich sein Nutzungsgrad verringert.
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Wärmespeichern
An den Einsatz von Wärmespeichern sind hohe Erwartungen geknüpft. Inwieweit diese sich im vollen Umfang werden realisieren lassen, muss sich erst noch zeigen. Im Idealfall müssten diese Anforderungen erfüllt werden:
Energetische Anforderungen
- hohe Energiedichte
- hohe Leistungsdichte
- geringe Verluste
- geringe Selbstentladung
- geringer Hilfsenergieverbrauch
- hoher Systemnutzungsgrad
Sicherheit der Systeme
- geringes Schadenspotenzial
- hohe Betriebssicherheit
Nutzungsdauer
- hohe Zyklenbeständigkeit
- lange kalendarische Lebensdauer
Umweltverträglichkeit über die gesamte Nutzungszeit
- Herstellung
- Einsatz
- Entsorgung bzw. Recycling
Wirtschaftlichkeit
- geringe Investitionskosten
- geringe Betriebskosten
Schon heute stehen zahlreiche Varianten der hier vorgestellten Speicher-Grundtypen für die sehr unterschiedlichen Nutzungsanforderungen zur Verfügung. Das Angebot wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich sehr stark erweitern.




















Kommentare
Einen Kommentar schreiben