Brand- und Elektrorisiken von E-Autos sind beherrschbar – von allen Akteuren
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Spektakuläre Fotos und Videos von Fahrzeugbränden haben in der öffentlichen Wahrnehmung zu Ängsten vor einer erhöhten Brandgefahr durch oder bei Elektroautos geführt. Doch die Schadenstatistiken der Versicherer belegen dies nicht. So gut wie alle Experten sind sich einig, dass bei einem Elektrofahrzeug kein höheres Brandrisiko besteht als bei einem mit Benzin oder Diesel angetriebenen Fahrzeug.
Brandrisiko Lithium-Ionen-Akku
Fakt bleibt jedoch, dass bei Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in Hochvoltfahrzeugen verbaut werden, ein Brandrisiko nie ganz auszuschließen ist. Denn mechanische Beschädigungen, sehr hohe oder sehr tiefe Temperaturen sowie elektrische Belastungen (innere oder äußere Kurzschlüsse, Überladen, Tiefentladung) können den gefürchteten „Thermal Runaway“ auslösen. Diese unkontrollierbare und autokatalytische (sich selbst verstärkende) chemische Reaktion erreicht Temperaturen bis zu 800 °C. Der Akku zerbirst und setzt seine Umgebung in Brand, wie unzählige Beispiele – von Golfcaddys über den Fahrradhandel bis zu Tiefgaragen und Busdepots – gezeigt haben. Vom Hersteller bis zum Nutzer eines mit Akku betriebenen Geräts oder Fahrzeugs muss jeder sich mit diesem Risiko auseinandersetzen.
Was Hersteller von Elektrofahrzeugen beachten müssen
Die komplexen und vielfach standardisierten Anforderungen an die Konformität und Sicherheit von Fahrzeugen umfassen auch Aspekte aus Elektrosicherheit und Brandschutz. So wird das Hochvoltsystem eines Fahrzeugs berührgeschützt ausgeführt und ist elektrisch vollständig von der Fahrzeugkarosserie isoliert. Ein Aufkleber an HV-Komponenten weist mit schwarzem Blitz im gelben Dreieck mit schwarzem Rahmen auf die Gefahr hin. Hochvoltleitungen und Verbindungskomponenten in Hybrid- und Elektrofahrzeugen sind an der Warnfarbe Orange für die Isolierung zu erkennen. Auch die Akkus selbst werden durch konstruktive Maßnahmen sicherer gemacht (Überdruckventile, Schmelzsicherungen, elektronische Überwachung u.Ä.).
Neueste Entwicklungen senken das Risiko
Diese Sicherheitsanforderungen werden weiter verbessert. So entwickelt z.B. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ein System, das über Veränderung der Impedanz frühzeitig Defekte erkennt und vor Akkubränden schützen soll. Ein kürzlich von Renault vorgestellter, gemeinsam mit Feuerwehren entwickelter Ansatz soll ein schnelles Löschen bei den gefürchteten Akkubränden erleichtern. Bei diesem sog. „Fireman Access System“ wird eine Öffnung im Batteriegehäuse mit einer kleinen Scheibe überklebt. Im Brandfall kann der Löschstrahl die Scheibe ablösen, sodass dann die Batteriezellen mit Wasser durchtränkt werden können; das Löschen erfolgt deutlich schneller. Mittelfristig könnten neue Akkutypen sowohl die Brandgefahr senken wie auch die Lithiumressourcen schonen. In der Entwicklung sind u.a. Festkörperbatterien und Natrium-Ionen-Batterien.
Kfz-Handwerk und Autowerkstätten
Neben den klassischen Brandschutzvorgaben müssen Kfz-Werkstätten gemäß ihren Gefährdungsbeurteilungen Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag, Kurzschlüsse und Störlichtbögen umsetzen. Neue Vorgaben der DGUV regeln seit 2021 die Qualifizierungen der Mitarbeitenden. Die DGUV Information 209-093 „Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen“ sieht ein Qualifikationskonzept mit den Stufen „Sensibilisierte Person“, „Fachkundig unterwiesene Person (FuP)“, „Fachkundige Person Hochvolt (FHV)“ sowie „Fachkundige Person für Arbeiten an unter Spannung stehenden HV-Systemen“ vor. Bei den Berufsgenossenschaften sind Betriebsanweisungen erhältlich, etwa zu Batterieladeanlagen oder zur Fehlersuche und zu Prüfarbeiten unter Spannung.
Tipp der Redaktion
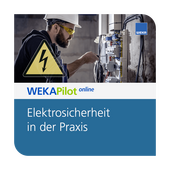
Mehr Beiträge zu diesem und vielen weiteren Themen finden Sie in dem Produkt „Elektrosicherheit in der Praxis”.
Retten – Löschen – Bergen
Elektromobilität betrifft auch die Verkehrspolizei, Feuerwehren, Rettungskräfte sowie Pannen- und Abschleppdienste. Der Umgang mit Elektrofahrzeugen ist nicht per se gefährlicher, aber alle Akteure müssen um die besonderen Risiken bei Fahrzeugen mit Hochvolt(HV)-Energiespeicher wissen. Kritische Anzeichen wieRauchentwicklung, Funken, Geräusche oder Erwärmung sind zu beachten, ebenso die Risiken durch ausgetretene brennbare und ätzende Elektrolyte oder giftige Gase usw.
Wenn bei schweren Unfällen HV-Komponenten beschädigt oder Leitungen abgerissen sind, ist eine Gefährdung der Retter nicht auszuschließen. Spannungsfreiheit ist von außen nicht erkennbar, daher muss das HV-System deaktiviert (siehe Rettungsdatenblatt) bzw. müssen die betroffenen Bereiche elektrisch isolierend abgedeckt werden. Eine Brandbekämpfung ist schwieriger als bei herkömmlichen Fahrzeugen, bei der Einsatztaktik gibt es jedoch keine großen Unterschiede. Handlungsempfehlungen für Feuerwehren liegen vor. Wichtig ist, dass HV-Batterien auch nach dem Löschen ausreichend gekühlt werden. Auch nachdem die Feuerwehr ein E-Auto an ein Abschleppunternehmen übergeben hat, kann beim Abtransport und bei der Entsorgung des ausgebrannten Fahrzeugs eine Rückzündungsgefahr bestehen.
Am Bergen beteiligte Personen sollten mindestens eine Unterweisung zur fachkundig unterwiesenen Person (FuP) absolviert haben, ein Abschleppunternehmen zudem eine Fachkraft für Hochvoltsysteme gemäß DGUV Information 200-005 beschäftigen. Verunfallte Elektrofahrzeuge sind stets im Freien und mit Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen und anderen Fahrzeugen abzustellen.
Downloadtipps der Redaktion
Gefährdungsbeurteilung: Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen
Hier gelangen Sie zum Download.
Gefährdungsbeurteilung: Betrieb von Hochvoltfahrzeugen
Hier gelangen Sie zum Download.
E-Book: Elektrosicherheit in der Elektromobilität
Rettungskarten für alle Elektrofahrzeuge
Wird bei einem Unfall die Batterie beschädigt, sollten Rettungskräfte wissen, wo schweres Gerät und Schneidewerkzeuge angesetzt werden dürfen, um nicht ungewollt eine – wider Erwarten nicht stromlose – Starkstromleitung zu durchtrennen. Eine aktuelle Rettungskarte für das Fahrzeugmodell stellt das Hochvoltsystem grafisch dar: Das Dokument sollte an einer Stelle platziert werden, die schnell zu finden und leicht zu erreichen ist. Der ADAC empfiehlt das „Versteck“ unter der Sonnenblende des Fahrersitzes. Wer für sein E-Fahrzeug keine Rettungskarte vom Hersteller oder Händler erhalten hat, findet sie beim ADAC und bei anderen Organisationen zum kostenfreien Download.
Brandschützer im Unternehmen
Elektromobilität wird zunehmend ein Thema für Fuhrparkleiter von Unternehmen und Organisationen. Gemeinsam mit den betrieblichen Arbeits- und Brandschützern sind verschiedene Szenarien zu betrachten:
- Das Unternehmen erweitert seine Firmenflotte um Elektrofahrzeuge.
- Beschäftigte stellen ihre privaten Elektrofahrzeuge auf dem Betriebsgelände ab oder parken sie – etwa Elektroroller oder E-Bikes – innerhalb von Betriebsgebäuden.
- Das Unternehmen plant eine öffentliche Ladeinfrastruktur auf dem Betriebsgelände.
Gefährdungsbeurteilungen müssen in jedem Fall die Gefahr von Fahrzeugbränden durch Akkus berücksichtigen und geeignete Konzepte zur Prävention und Brandbekämpfung vorlegen.
Lagern und Laden von Akkus im Betrieb
Ob E-Scooter, Elektrostapler oder E-Auto, die Brandrisiken beziehen sich nicht nur auf Situationen mit dem Elektrofahrzeug im innerbetrieblichen oder öffentlichen Verkehr, sondern auch auf das Laden oder das Lagern von Akkus unter ungünstigen Bedingungen. Denn Lithium-Ionen-Akkus finden sich in vielen Betrieben längst in ganz unterschiedlichen Werkzeugen und Elektrogeräten. Die Vorgaben zum sicheren Laden und Lagern der unterschiedlichen Typen von Li-Ionen-Akkus sollten innerbetrieblich bekannt sein. Alle Beschäftigten, die mit Akkus zu tun haben, müssen dazu unterwiesen werden. Als Grundlage kann das VdS-Merkblatt 3103 „Lithiumbatterien“ dienen; dazu kommen die Vorgaben der jeweiligen Hersteller. Sogenannte F90-Sicherheitsschränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten ermöglichen ein sicheres Laden und Lagern von Akkus, alarmieren im Brandfall und begrenzen die Folgeschäden von Bränden oder Explosionen.
Elektrofahrzeuge als Arbeitsmittel
Im Arbeitsschutzrecht fallen betrieblich genutzte Elektrofahrzeuge unter Arbeitsmittel, d.h. unter die Betriebssicherheitsverordnung und deren Prüfpflichten. Vor ihrer Benutzung muss eine Einweisung stattfinden zu den potenziellen Gefährdungen beim Bedienen, Laden usw. Erstmalige Nutzer müssen sich auf eine andere Fahrweise einstellen (Overtapping-Effekt) sowie auf ein anderes Verhalten von Fußgängern und Radfahrern aufgrund der geringeren Motorgeräusche. Die jährliche verpflichtende Sicherheitsunterweisung sollte auch die Verhaltensregeln umfassen, wie sie privaten E-Fahrzeug-Nutzern empfohlen werden (siehe unten).
Betreiber von Ladeinfrastruktur
Wer zum Anbieter von Ladestationen wird, muss eine Vielzahl von Mindestanforderungen erfüllen. Technische Aspekte regelt die Ladesäulenverordnung, dazu kommen Vorgaben des Eichrechts, die Meldepflicht bei der Bundesnetzagentur und viele weitere Aspekte wie Abrechnungsmethoden oder Barrierefreiheit. Auch Unternehmen, die auf eigenem Gelände Lademöglichkeiten einrichten wollen, sollten dies frühzeitig mit Behörden und ihrem Sachversicherer abstimmen, z.B. hinsichtlich einer geeigneten Brandmeldetechnik für Bereiche mit Ladeinfrastruktur. Am sichersten sind Ladestationen im Freien und mit ausreichend Abstand zu Gebäuden und brennbaren Materialien. Auch wer eine Ladestation „nur“ über den elektrischen Hausanschluss betreiben will, muss sicherstellen, dass die gesamte elektrotechnische Infrastruktur vorschriftsgemäß von einer qualifizierten Elektrofachkraft (EFK) geplant, installiert und gewartet wird.
Was müssen Garagenbesitzer beachten?
In einer baurechtskonformen – gemäß der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslands errichteten – Garage steht dem Installieren eines zertifizierten Ladegeräts vonseiten des Bauordnungsrechts in der Regel nichts entgegen. Vor dem Installieren einer Ladestation in einer Garage ist zu empfehlen, die Planung mit der Bauaufsichtsbehörde und dem betrieblichen Brandschutzbeauftragten abzustimmen, auch die zuständige lokale oder Werksfeuerwehr sollte beteiligt werden. Dazu können Forderungen der Brand- bzw. Gebäudeversicherung kommen. Je nach Größe einer Garage werden Brandmeldeanlagen mit
- Rauch- oder Wärmemeldern,
- Sprinkleranlagen,
- einer ausreichenden Löschwasserversorgung sowie
- mit einem wirksamen Rauch- und Wärmeabzug
empfohlen oder verpflichtend gefordert. Nach Möglichkeit sollten Ladestationen für Elektrofahrzeuge im oberirdischen Teil einer mehrgeschossigen Garage vorgesehen werden und nahe von Ein- und Ausfahrten. Dies erleichtert nicht nur ein Löschen, sondern auch ein Bewegen des Fahrzeugs – etwa per Winde – nach draußen, um es im Freien zu löschen und zu beobachten.
Verbraucher und Fahrzeugnutzer
Jeder, der erwägt, vom Verbrenner auf ein E-Auto umzusteigen, wird früher oder später auf das Thema Brandgefahr stoßen, weil irgendein Bekannter oder Nachbar ihn vor der vermeintlich erhöhten Brandgefahr warnt. Wie oben bereits gesagt, lassen die Zahlen und Statistiken eine solche Aussage nicht zu. Gleichwohl gilt es, sich der Gefahren durch Lithium-Ionen-Akkus und Hochvoltsysteme stets bewusst zu sein und einige Grundregeln zu beachten:
- Fahrzeug regelmäßig inspizieren und warten lassen (Akku, Ladeeinrichtung u.Ä.); je nach Hersteller und Modell jährlich, alle zwei Jahre bzw. nach Laufleistung
- Angaben des Herstellers ernst nehmen, z.B. zum für das Fahrzeugmodell freigegebenen Zubehör
- sich die Sichtprüfung angewöhnen, d.h., vor jedem Laden – auch wenn die Ladesäule keine Fehlermeldung anzeigt – Kabel, Isolierung, Stecker usw. aufmerksam anschauen; Beschädigungen und Defekte, z.B. durch Vandalismus, unverzüglich dem Betreiber der Ladestation melden
- ein defektes Elektrofahrzeug oder nach einem Unfall niemals in der Garage abstellen
Bei Defekten und Schäden sollte man die Elektrofahrzeuge zur Reparatur oder Kontrolle stets an Profis übergeben und als Laie von HV-Leitungen, Wechselrichter, Bordladegerät usw. die Finger lassen.
Weitere Beiträge zum Thema
Ladeeinrichtungen bei der Elektroinstallation rechtzeitig einplanen
Ladeinfrastruktur: Anforderungen an die Elektroinstallation
Ladeinfrastruktur Elektromobilität: Neuer technischer Leitfaden für die Praxis
Ladeinfrastruktur Elektromobilität: Neuer technischer Leitfaden für die Praxis (Teil 2)




















Kommentare
Einen Kommentar schreiben