EMV-Richtlinie in der Industrie: Was Elektrofachkräfte bei Planung, Montage und Prüfung beachten müssen
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Die elektromagnetische Verträglichkeit elektrischer Betriebsmittel ist rechtlich verpflichtend. Grundlage bildet die EU-Richtlinie 2014/30/EU, ergänzt durch das nationale EMV-Gesetz (EMVG). Beide Vorschriften greifen ineinander. Die Richtlinie richtet sich an Hersteller, Inverkehrbringer und Betreiber, das EMVG konkretisiert deren Pflichten auf nationaler Ebene. Für Elektrofachkräfte in der industriellen Praxis bedeutet das: Jede Komponente, die elektromagnetische Störungen verursachen kann oder durch sie beeinträchtigt werden könnte, unterliegt den Bestimmungen. Ausnahmen gelten nur bei klar dokumentierter Unkritikalität, diese wiederum setzt fundierte EMV-Kenntnisse voraus.
Geräte, ortsfeste Anlagen und bewegliche Kombinationen
Die Richtlinie unterscheidet zwischen Geräten, ortsfesten Anlagen und beweglichen Anlagen. Geräte sind fertige Apparate oder Kombinationen, die für Endnutzer bereitgestellt werden. Ortsfeste Anlagen sind dauerhaft installierte Gesamtheiten von Geräten und Einrichtungen an einem festgelegten Standort. Bewegliche Anlagen umfassen Kombinationen, die wechselnd an unterschiedlichen Orten betrieben werden. Für Elektrofachkräfte entscheidend: Nur ortsfeste Anlagen sind von der CE-Kennzeichnung ausgenommen, müssen jedoch trotzdem die Anforderungen an Störaussendung und Störfestigkeit erfüllen. Diese Anforderungen sind identisch mit denen für Geräte und resultieren aus Anhang I der Richtlinie.
Tipp der Redaktion
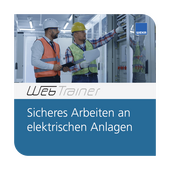
Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen
- E-Learning-Kurs für Fachkräfte der Elektrotechnik
- Mit Wissenstest und Teilnahmebestätigung
- Sorgen Sie für ein sicheres elektrotechnisches Arbeiten in Ihrem Betrieb.
Verantwortung des Elektrofachbetriebs bei ortsfesten Anlagen
Sobald eine ortsfeste industrielle Anlage geplant oder errichtet wird, geht die Verantwortung für deren EMV-gerechte Ausführung auf die ausführende Elektrofachkraft über. Der Betreiber bleibt zwar in der Pflicht zur Dokumentation und Einhaltung, die fachgerechte Installation nach dem Stand der Technik liegt jedoch beim Ausführenden. Dies umfasst die korrekte Auswahl der Betriebsmittel, deren Integration, den Potenzialausgleich, die Verlegung von Leitungen, die Trennung von Energie- und Steuersignalen sowie die Vermeidung von EMV-Koppelpfaden. Die Dokumentation muss darlegen, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten wurden, etwa durch Bezugnahme auf EN 61000-6-2 für industrielle Umgebungen oder EN 61439-3 für Installationsverteiler.
Konformitätsvermutung durch harmonisierte Normen
Die Richtlinie definiert keine konkreten Grenzwerte, sondern verweist auf den Stand der Technik, konkretisiert durch harmonisierte europäische Normen. Werden diese Normen eingehalten, wird die Konformität mit der Richtlinie vermutet. Für Elektrofachkräfte ist relevant, ob die jeweils verwendete Norm zum Zeitpunkt der Installation noch gültig ist. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/660 hat unter anderem die Norm EN 55103-2 für professionelle Audiogeräte gestrichen und durch EN 55035 ersetzt. Ähnliche Umstellungen betreffen Installationsverteiler (EN 61439-3), Flurförderzeuge (EN 12895+A1) und Schütze (EN IEC 60947-4-1). Die jeweils aktuelle Fundstelle im EU-Amtsblatt entscheidet darüber, ob eine Norm als harmonisiert gilt.
EMV-gerechte Installationspraxis in Industrieumgebungen
In industriellen Anwendungen treten hohe Stromstärken, große Schalthäufigkeiten, lange Leitungslängen und potenziell empfindliche Steuerungssysteme nebeneinander auf. Störquellen und Störempfänger sind häufig nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Elektrofachkräfte müssen deshalb Störquellen systematisch erfassen. Netzteile, Frequenzumrichter, elektronische Vorschaltgeräte, Relais mit hoher Schaltfrequenz, Motorstarter mit steilen Flanken oder HF-Emittenten wie Schweißanlagen erzeugen breitbandige Emissionen, die über galvanische, kapazitive oder induktive Kopplung übertragen werden können.
Downloadtipps der Redaktion
E-Book: Die neue Maschinenverordnung
Hier gelangen Sie zum Download.
Checkliste für die Sichtprüfung
Hier gelangen Sie zum Download.
E-Book: Haftung der Elektrofachkraft
Typische Fehlerquellen in der Praxis sind parallel verlegte Steuer- und Leistungskabel, unzureichende Abschirmung, fehlende Erdung, lange PE-Pfade oder die Montage in elektromagnetisch ungünstigen Umgebungen. Auch der Verzicht auf Netzentstörung bei Geräten ohne CE-Kennzeichen ist häufig. Dabei gilt: Jeder Einbau nicht geprüfter Komponenten in eine ortsfeste Anlage verlagert die Verantwortung auf den Installateur. Die Störfestigkeit des Gesamtsystems muss gewährleistet bleiben.
Geräteeinbau in ortsfeste Anlagen: Wann gelten Ausnahmen
Ein Gerät, das ausschließlich für den Einbau in eine bestimmte ortsfeste Anlage vorgesehen und nicht am Markt verfügbar ist, muss nicht die vollständigen Anforderungen für Geräte erfüllen. Stattdessen muss der Hersteller in der Dokumentation klar benennen, für welche Anlage das Gerät vorgesehen ist, welche EMV-Merkmale diese aufweist und welche Maßnahmen beim Einbau zu treffen sind. Die Verantwortung für die EMV-Konformität der Anlage verbleibt beim Betreiber. Für Solche Komponenten dürfen nur eingebaut werden, wenn die zugehörige technische Dokumentation vollständig ist und den EMV-Nachweis für die Gesamtanlage nicht gefährdet.
EMV-Prüfung von Industrieanlagen durch die Bundesnetzagentur
Die Bundesnetzagentur ist in Deutschland für die Marktüberwachung zuständig. Sie kann ortsfeste Anlagen stichprobenartig überprüfen oder bei begründetem Verdacht Maßnahmen anordnen. Dazu zählt die Anforderung technischer Unterlagen ebenso wie Vor-Ort-Begehungen oder EMV-Messungen. Wird ein Verstoß gegen die Anforderungen festgestellt, kann sie Nachbesserung, Stilllegung oder Rückbau verlangen. Elektrofachkräfte sollten deshalb sicherstellen, dass alle EMV-relevanten Dokumente projektbegleitend erstellt und dauerhaft aufbewahrt werden. Dazu zählen Schaltpläne, EMV-Konzept, Nachweise verwendeter Normen, Betriebsanleitungen, Montagehinweise und Prüfprotokolle.
Anforderungen an den EMV-Nachweis bei Erweiterung und Umbau
Veränderungen an ortsfesten Anlagen, etwa durch Erweiterung, Umbau oder Austausch von Komponenten, erfordern eine erneute Betrachtung der EMV-Konformität. Die einmal erstellte Dokumentation verliert in dem Moment ihre Gültigkeit, in dem sich das Emissionsverhalten der Anlage verändert. Elektrofachkräfte sind dann verpflichtet, die bestehenden Nachweise zu aktualisieren. Dies umfasst die Überprüfung von Schirmung, Erdung, Netzfilterung und Koppelverhalten. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den hinzugefügten Komponenten, sondern auf der Gesamtanlage als elektromagnetisches System.
Interne Fertigungskontrolle und CE-Kennzeichnung bei Geräten
Für Geräte, die als eigenständige Einheiten auf dem Markt bereitgestellt werden, schreibt die Richtlinie ein Konformitätsbewertungsverfahren vor. Die gebräuchlichste Form ist die interne Fertigungskontrolle nach Anhang II der Richtlinie. Alternativ kann eine EU-Baumusterprüfung mit Erklärung der Übereinstimmung nach Anhang III erfolgen. Unternehmen, die Geräte in Eigenproduktion fertigen und in Verkehr bringen, etwa Steuergehäuse, müssen dieses Verfahren durchführen. Dazu gehört die Erstellung technischer Unterlagen, Durchführung von EMV-Messungen, Erstellung der EU-Konformitätserklärung und Anbringung der CE-Kennzeichnung. Eine fehlerhafte Kennzeichnung kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
Zusammenspiel mit weiteren Richtlinien und Normen
EMV-Anforderungen gelten nicht isoliert. Häufig greifen parallel weitere Richtlinien, etwa die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG oder die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU. Die EU-Konformitätserklärung muss alle zutreffenden Richtlinien aufführen. Auch die CE-Kennzeichnung bezieht sich dann nicht nur auf die EMV-Richtlinie, sondern auf das gesamte Regelwerk. Für Industrieanlagen mit Funkmodulen, ferngesteuerten Antrieben oder netzwerkfähigen Komponenten ist der Abgleich zwingend erforderlich. Die korrekte Einordnung beeinflusst das anzuwendende Konformitätsverfahren und die Dokumentationspflichten.
Zusammenfassung: Pflichtenprofil für Elektrofachkräfte
Wer als Elektrofachkraft in der Industrie arbeitet, muss die EMV-Anforderungen auf vier Ebenen beherrschen: erstens bei der Auswahl von Geräten, zweitens bei deren Integration in ortsfeste Anlagen, drittens bei der normgerechten Installation und viertens bei der technischen Dokumentation. Dies umfasst fundierte Kenntnisse zu Grenzwerten, Koppelmechanismen, Schutzkonzepten und Prüfverfahren. Die Verantwortung endet nicht bei der Inbetriebnahme. Auch langfristige Funktionssicherheit und Störfreiheit liegen im Aufgabenbereich des Fachbetriebs.
Die EMV-Richtlinie ist keine Formalität, sondern technischer Maßstab für die gesamte Planungs- und Ausführungskette. Ihre Anforderungen lassen sich nicht delegieren oder umgehen. Fachgerechte EMV-Planung bedeutet, industrielle Anlagen systematisch gegen Störungen abzusichern, dokumentiert, messbar, nachvollziehbar.




















Kommentare
Einen Kommentar schreiben