Künstliche Intelligenz: neuer Schwung für die Energiewende
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Künstliche Intelligenz (KI) wird immer öfter im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien genannt und bisweilen als „Treiber der Energiewende“ bezeichnet. Denn durch rapide steigende Datenmengen wächst die Komplexität von Auswertungen und Analysen. Hier setzen Konzepte für smarte Lösungen an. Für ein durch KI unterstütztes und damit besonders effizientes Energiemanagement werden Kosteneinsparungen von mehreren Milliarden Euro prognostiziert.
Digitale Technologien für mehr Nachhaltigkeit
Zunächst muss festgestellt werden, dass Digitalisierung Energie kostet und Rohstoffe benötigt. Ohne elektrische Energie und ohne eine Hardware − aus Kunststoffen, Metallen und seltenen Erden − sind digitale Technologien kaum vorstellbar. Dazu kommt, dass künstliche Intelligenz selbst ein großer Stromfresser ist und den Energieverbrauch von Rechenzentren steigen lässt. Die entscheidende Frage ist daher, wie die Gesamtbilanz aussehen wird, wenn digitale und smarte Technologien künftig immer mehr Energieflüsse und Stoffkreisläufe überwachen und steuern. Hier deuten sich große Potenziale an. Erste smarte Anwendungen sind bereits im Einsatz, andere werden intensiv erforscht.
Intelligente Stromzähler werden Pflicht
Mithilfe intelligenter Strommessgeräte soll Energie effizienter genutzt und das Stromnetz entlastet werden. Das ist der Grundgedanke hinter dem 2023 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW). Ziel ist, das sogenannte Smart Metering schneller voranzubringen. Bis 2025 wird das Einbauen intelligenter Messsysteme verpflichtend für Haushalte mit einem Verbrauch ab 6.000 kWh/Jahr oder PV-Anlagen ab 7 kW installierter Leistung.
Tipp der Redaktion
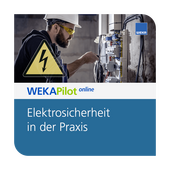
Das Nachschlagewerk für die Elektrofachkraft
Organisation, Durchführung und Dokumentation elektrotechnischer Prüfungen – „Elektrosicherheit in der Praxis“ unterstützt Sie bei der Umsetzung der Elektrosicherheit in Ihrem Unternehmen.
Die Technologie des Smart Metering gilt als ein Schritt zum Smart Grid, dem intelligenten Stromnetz der Zukunft. Nach der Umrüstung auf intelligente Messsysteme − Stromzähler kombiniert mit Modulen zur Kommunikation und Analyse − erfassen die neuen Geräte alle relevanten Daten und senden sie an den Messstellenbetreiber (MSB). Der Datenschutz soll durch die Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) gewährleistet sein. Erleichterungen für das Eichen von Smart-Meter-Gateways wurden bereits angestoßen. Ab 2032 sollen digitale Stromzähler in Deutschland der Standard sein.
Viertelstundenwerte statt Jahresbilanzen
Infolge der digitalen und intelligenten Messtechnik werden statt Jahreswerten Viertelstundenwerte erfasst und der Stromverbrauch wird deutlich präziser überwacht. Die Vorteile für den Verbraucher:
- Das Ablesen von Stromzählern vor Ort entfällt inklusive des Aufwands für Terminvereinbarung, ggf. Schlüsselübergabe an Nachbarn usw.
- Die Abrechnung soll zeitnäher erfolgen und transparenter werden. So kann z.B. bei einem Mieterwechsel die Abrechnung der Stromkosten künftig tagesgenau erfolgen.
- Jeder kann seine Stromverbräuche online einsehen, Energiefresser sofort erkennen und seine persönliche Energiebilanz leichter optimieren.
Mit der neuen Messfrequenz explodiert die Menge an erzeugten Daten. Künstliche Intelligenz soll helfen, diese Daten zur Lastprognose zu nutzen, etwa für schwer vorhersagbare Spitzenlasten. Aus Sicht des Energieversorgers ist zudem wichtig, dass auch der von privaten Haushalten erzeugte Strom intelligent und in Echtzeit erfasst wird (s.u.). Damit lassen sich Verbrauchs- und Einspeisedaten effizienter auswerten und die Steuerung des Energienetzes leichter anpassen.
KI überwacht Windräder
Künstliche Intelligenz soll künftig helfen, den Zustand von Windenergieanlagen zu überwachen. Das ist keine triviale Aufgabe, denn für einen effizienten und sicheren Betrieb von Windrädern müssen Tausende von Daten berücksichtigt werden. Das reicht von den Wetterverhältnissen (Temperatur, Luftströmung usw.) über physikalische Parameter (Druckverhältnisse) bis hin zu den Energieflüssen und dem Zustand der belasteten Bauteile wie etwa der Stellung des Rotorblatts. Diese riesigen Datenmengen zu überwachen, Abweichungen sofort zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren, ist nur durch automatisierte digitale Prozesse zu leisten.
Künstliche Intelligenz soll diesen Prozess noch effizienter machen, denn sie findet Muster in großen Datensätzen und arbeitet rund um die Uhr mit gleicher Aufmerksamkeit. Damit gelingt es einer KI beispielsweise, die Turbinen in einem Windpark zu synchronisieren und sie stets optimal zu den aktuellen Luftströmungen auszurichten. Ebenso erkennt eine KI frühzeitig Fehlfunktionen und kritische Situationen. Damit werden Stillstandszeiten minimiert und Folgeschäden verhindert oder begrenzt. Im Projekt „Condition Monitoring 4.0 bei Windenergieanlagen (AutoDiagCM)“ nutzen Forscher das sogenannte „maschinelle Lernen (ML)“, ein Teilgebiet der KI, zur automatisierten Diagnose von Schäden an Windenergieanlagen.
Downloadtipps der Redaktion
E-Book: Photovoltaikanlagen normkonform errichten
Hier gelangen Sie zum Download.
E-Book: Erstprüfungen nach DIN VDE 0100-600
Hier gelangen Sie zum Download.
Gefährdungsbeurteilung: Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen
Hier gelangen Sie zum Download.
Checkliste: Funktionale Aspekte – Energieeffizienz
KI steuert die Wartung von PV-Anlagen
Wie die Solarbranche von KI profitieren kann, will das Projekt „Kick-PV“ zeigen. Die Abkürzung steht für „KI-basierte Charakterisierung und Klassifizierung von Photovoltaikanlagen zur prädiktiven Wartung“. Diagnose und Wartung sollen aus der Ferne erfolgen und KI soll die großen Datenmengen auswerten. Damit sollen z.B. Ursachen von Leistungseinbrüchen in Photovoltaik-Kraftwerken frühzeitig erkannt und regenerative Energiesysteme auf Dauer deutlich berechenbarer werden.
KI für die Versorgungssicherheit
Eine „grüne“ und gleichzeitig allzeit sichere Stromversorgung ist keine geringe Herausforderung. Denn die Stromausbeute bei erneuerbaren Energien schwankt je nach Wetter, Wind, Jahreszeit und Tageszeit teilweise erheblich. Dazu kommt, dass die Energieversorgung in Deutschland durch die Energiewende nicht nur dezentraler wird, sondern auch komplexer. Bereits mehr als 1,7 Millionen dezentrale Erzeuger speisen inzwischen elektrische Energie − gewonnen aus Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft oder Biogas − ins Netz.
Für eine sichere Stromversorgung ist jedoch wichtig, dass kalkulierbar ist, wo und wann voraussichtlich wie viel Energie produziert werden wird. Ob es beispielsweise in den nächsten Tagen viel Wind geben und wie viele Stunden die Sonne scheinen wird, wird längst durch künstliche Intelligenz vorhergesagt. Künftig soll das Monitoring zu Wetter, Energieerzeugung und den − ebenfalls schwankenden − Verbräuchen (Gebäude, Prozesswärme, Elektromobilität usw.) per KI erfolgen. Denn gerade bei solchen gigantischen Datenmengen kann eine KI ihre Stärken voll ausspielen. Damit könnten die Voraussagen von Stromerzeugung und Stromverbrauch immer präziser werden. Ein intelligentes Stromnetz soll nicht nur die Verteilung und Speicherung von Energie optimieren und damit die Effizienz im Energienetz steigern, sondern auch zu einer stabilen Energieversorgung beitragen.
KI optimiert Prozesse
Die Ferndiagnose und Fernwartung von Maschinen, Anlagen und Prozessen sollen von KI profitieren. Auch hier steigen auf dem Weg zur Smart Factory und dem Internet der Dinge (IoT) die durch Sensorik und RFID-Tags generierten Datenmengen rapide an. Ein menschlicher Überwacher kommt an Grenzen, diese Datenfülle zu bewältigen − schon gar nicht in Echtzeit. Künstlich intelligente Systeme bieten hier viele Ansatzpunkte. Besonders häufig genannt als Beispiel für den effizienten Einsatz von KI wird die vorausschauende Wartung. Das Energieunternehmen E.ON berichtet beispielsweise, dass man einen selbstlernenden Algorithmus entwickelt hat, der prognostiziert, wann die Mittelspannungskabel eines Stromnetzes ausgewechselt werden müssen. Ähnliche Ansätze werden im Konzept der Predictive Maintenance für andere Verschleißteile verfolgt.
Auch hier ist es die Fülle der in technischen Prozessen anfallenden und durch sie erzeugten Daten, Parameter, Variablen und Messwerte, die den Einsatz künstlich intelligenter Auswertesysteme nahelegt. Wo KI es schafft, ungeplante Ausfälle von Maschinen oder Stillstand von Anlagen zu vermeiden, kommt dies nicht nur der Energiebranche zugute.
Das „denkende“ Energienetz
Dass künstlich intelligente Systeme sich vielfach am menschlichen Gehirn orientieren, zeigt sich beim Kompetenzzentrum Kognitive Energiesysteme (K-ES) schon in seinem Namen. Denn Kognition bedeutet so viel wie Erkennen sowie jede Form von geistiger Aktivität. Wenn von einer kognitiven Energiewirtschaft mit kognitiven Energienetzen die Rede ist, schwingt dabei mit, dass diese Systeme selbstständiger werden sollen. Sie lernen stetig hinzu, entwickeln sich weiter und können dadurch immer autonomer agieren. Dass der Amok laufende Zentralcomputer eines Energieversorgers in − gar nicht mehr so ferner − Zukunft beschließen könnte, uns den elektrischen Strom abzustellen, weil der Planet Erde besser ohne den Homo sapiens auskommt, gehört zur Science-Fiction. Dass bei aller Begeisterung für KI noch viele Fragen zu klären sind − vom Datenschutz bis hin zur Angreifbarkeit von Energieversorgung und Infrastrukturen durch Hacker und Cyberkriminelle −, ist dagegen Realität.




















Kommentare
Einen Kommentar schreiben