Hochvoltspeicher: der sichere und verantwortungsvolle Umgang
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Seit Jahren boomt die Elektrifizierung von Personenkraftwagen. Um eine ausreichend hohe elektrische Leistung für den Fahrzeugbetrieb sicherzustellen, sind moderne Elektrofahrzeuge mit einem Hochvoltantriebssystem ausgestattet, das es ermöglicht, den Motor des E-Autos mit einer entsprechend hohen Spannung zu versorgen. Da die von einer Hochvoltbatterie zur Verfügung gestellten Spannungen für den Menschen eine potenziell tödliche Gefahr darstellen, müssen im Umgang mit Hochvoltspeichern verschiedene Sicherheitsvorkehrungen ergriffen werden.
DGUV-Publikation liefert wertvolle Infos
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) veröffentlichte 2022 eine Broschüre (FBHM-124) mit dem Titel „Fachbereich AKTUELL − Umgang mit Hochvoltspeichern“. Die Publikation dient Unternehmern, Versicherten sowie Elektrofachkräften als Handlungshilfe für den verantwortungsvollen Umgang mit Hochvoltspeichern. Sie unterstützt zudem bei der Ermittlung der Anforderungen an Hochvoltspeicher, Systeme, Prozesse und Personen sowie bei der Erstellung und Umsetzung der individuellen Gefährdungsbeurteilung.
Gefahren bei unsachgemäßem Umgang
Insbesondere bei unsachgemäßer Handhabung oder beim Auftreten anderer äußerer Einflüsse bergen Lithium-Ionen-Batterien (LIB) Risiken. Für die LIB-Speichersysteme ist der hohe Energieinhalt pro Volumen charakteristisch. Unter äußeren Einflüssen (z.B. Beschädigungen, unsachgemäßes Aufladen) kann es dazu kommen, dass Lithium-Ionen-Zellen unvorhersehbar in einen unkontrollierten Reaktionszustand (Thermal Runaway) übergehen. Dabei handelt es sich um einen stark exothermen Prozess, der dadurch gekennzeichnet ist, dass toxische und/oder brennbare oder explosionsfähige Inhaltsstoffe sowie brennendes Material aus den Zellen austreten können. Im Fall eines unsachgemäßen Umgangs, bei Überhitzung, bei einer mechanischen Beschädigung oder beim Auftreten eines internen Fehlers muss bei Lithium-Ionen-Akkus mit diesen Gefährdungen gerechnet werden:
- Brand- und Explosionsgefährdungen (durch elektrisches Aufheizen/Entzünden durch Kurzschluss)
- elektrische Gefährdungen durch elektrische Körperdurchströmung oder Lichtbögen
- Gefährdungen durch Gefahrstoffe (durch Batteriebestandteile oder deren Reaktions- oder Zersetzungsprodukte)
- mechanische Gefährdungen (Projektilbildung, wenn durch Kurzschlüsse glühende Metallteile und andere − unter Umständen brennende − Teile aus der Batterie ausgestoßen werden)
Kritische Reaktionen können vor allem beim Ladevorgang von Lithium-Ionen-Batterien entstehen. Die Tatsache, dass Lithium-Ionen-Batterien bereits seit 1993 als Gefahrgut eingestuft sind, zeigt, dass immer mit kritischen Reaktionen zu rechnen ist.
Entstehung gefährlicher Brandgase
Beim Brand einer Lithium-Ionen-Batterie entstehen hohe Temperaturen. Es bilden sich zudem beachtliche Mengen toxischer und korrosiver Brandgase, die auch die Umwelt schädigen und die Umgebung kontaminieren können.
In der Batterie entstehen infolge chemischer Reaktion verschiedene entzündbare oder brandfördernde Gase, die freigesetzt werden. Es handelt sich um eine exotherme Reaktion, sodass es zu einer Selbsterhaltung oder sogar Selbstbeschleunigung der Reaktion kommen kann. Wegen der Zellchemie funktionieren Brandlöschverfahren, die den Brand durch Sauerstoffentzug beenden, bei Lithium-Ionen-Batterien nicht. Daher lassen sich LIB-Brände schwer löschen.
So kann es zum Brand einer LIB kommen
Sollte eine Zelle sich beispielsweise durch Hitze, Überladung oder mechanische Beschädigung zersetzen oder thermisch durchgehen, entstehen Temperaturen bis zu 1.400 °C. In der Folge platzt die Zelle und bläst ihren Inhalt unter Überdruck nach außen ab. Wegen ihrer chemischen Zusammensetzung kann eine Lithium-Ionen-Batterie ohne Fremdeinwirkungen thermisch reagieren. Als „interne“ Reaktion zählt u.a. auch ein durch Dendriten-Bildung zerstörter Separator, der einen internen Kurzschluss verursacht. Bei thermisch reagierenden Lithium-Ionen-Akkus hängen der Reaktionsverlauf und die Reaktionszeit wesentlich vom Ladezustand und Energieinhalt ab. In Tabelle 1 sind Ursachen aufgeführt, die im Produktlebenszyklus einer Lithium-Ionen-Batterie einen Brand auslösen oder zu einer unerwünschten Reaktion führen können.
Tipp der Redaktion
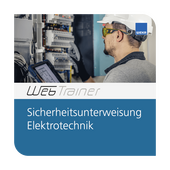
Sicherheitsunterweisung Elektrotechnik
- Erst- und Wiederholungsunterweisung für Elektrofachkräfte
- Modern und ohne Aufwand schulen
- Für die Elektrosicherheit in Ihrem Betrieb nach DGUV- und VDE-Vorschriften
|
Lebenszyklus LIB
|
Ursachen für mögliche Schäden |
| Herstellung |
|
| Transport |
|
| Montage |
|
| Verwendung |
|
| Service/Wartung |
|
| Recycling |
|
Tab. 1: Mögliche Schadensursachen
Behandlung wie ein Gefahrstoff
Bei sachgemäßer Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus werden keine Gefahrstoffe freigesetzt. Im Schadensfall können jedoch Inhaltsstoffe bzw. Reaktionsprodukte austreten, die als Gefahrstoffe gelten. Deshalb trifft die VdS 3103 „Lithium-Batterien“ auf Basis der Erkenntnis aus Brandversuchen folgende Aussage: „Lithium-Batterien sind grundsätzlich wie ein Gefahrstoff zu behandeln.“
Der Hintergrund dieser Aussage ist also, dass im Falle einer etwaigen Havarie der Lithium-Ionen-Batterie von einer Gefährdung durch Gefahrstoffe ausgegangen werden muss. Dieser Umstand muss bei der Gefährdungsbeurteilung zwingend Berücksichtigung finden. Viele (auch krebserzeugende) Gefahrstoffe können − insbesondere im Zusammenhang mit Brandereignissen − mit Lithium-Ionen-Batterien in Verbindung gebracht werden. Diese Erkenntnis ist das Ergebnis zahlreicher Untersuchungen. Beispielsweise ist das oft im Elektrolyt enthaltene Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) äußerst wasserempfindlich, sodass es mit der Luftfeuchtigkeit unter Bildung von Fluorwasserstoff (HF, Flusssäure) und Phosphorsäure (H₃PO₄) reagiert. Der Nebel gilt deshalb als entzündbar, giftig und ätzend. Er kann auf der Hautoberfläche Verätzungen verursachen.
Beim Brand von Lithium-Ionen-Batterien kann es u.a. zur Freisetzung folgender Stoffe/Gefahrstoffe kommen:
- Cobalt
- Ethylencarbonat
- Fluorwasserstoff
- Graphit
- Kohlenmonoxid
- Lithiumhexafluorophosphat
- Mangan
- Methylencarbonat
- Nickel
- Phosphorwasserstoffverbindungen
- Wasserstoff
Die aufgeführten Stoffe oder Zersetzungsprodukte können, abhängig von der Zellchemie, sehr stark differieren.
Gefahrstoffsystem
Das Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (GESTIS-Stoffdatenbank) enthält nützliche Informationen zu spezifischen Gefährdungen sowie zum Umgang mit den in der LIB verbauten Gefahrstoffen.
Anforderungen an die betriebliche Notfallvorbereitung
Die Gefährdungsbeurteilung beinhaltet die Festlegung geeigneter Notfallmaßnahmen. Dabei gilt es, wie folgt vorzugehen:
- Detektieren (Erwärmung, Rauch, mechanische Verformung, Batteriemanagementsystem)
- Separieren
- Analysieren
Die Festlegung des betrieblichen Notfallmanagements orientiert sich am Zustand der Lithium-Ionen-Batterie. Hierfür muss ermittelt werden, welches Ereignis eingetreten ist. Zudem muss festgelegt werden, wie dieses Ereignis zu bewerten ist. In Tabelle 2 ist als Beispiel das Herunterfallen einer Lithium-Ionen-Batterie skizziert.
Downloadtipps der Redaktion
E-Book: VDE 0701 und VDE 0702
Hier gelangen Sie zum Download.
Gefährdungsbeurteilung: Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen
Hier gelangen Sie zum Download.
Gefährdungsbeurteilung: Gefahrenarten (Gefährdungsfaktoren)
Hier gelangen Sie zum Download.
Unterweisung: Benutzen von elektrischen Betriebsmitteln
|
Detektieren der erkennbaren Reaktionen an einer sicheren Abstellfläche
|
Sofortmaßnahmen/Analysieren der Bewertungskriterien | Mögliche Folgemaßnahmen |
|
|
|
| keine visuell erkennbare Deformation oder Beschädigungen |
Analysieren der Bewertungskriterien:
|
Tab. 2: Beispiel einer Notfallvorbereitung: Herunterfallen einer Lithium-Ionen-Batterie – Ereignisse und Maßnahmen
Zur Durchführung des betrieblichen Notfallmanagements muss festgelegt werden, welche Person welche Beurteilung vornehmen und welche Maßnahme durchführen darf. Eine entsprechende Dokumentation kann im Rahmen einer Qualifizierungsmatrix erfolgen.
Für auffällige oder defekte Lithium-Ionen-Batterien gilt, dass sie nur mit den im Notfallmanagement festgelegten Transportmitteln innerbetrieblich transportiert werden dürfen. So kann ein Ereignis detektiert werden:
- Fahrzeugparameter (z.B. Daten aus Steuergeräten)
- Rauchmelder
- Sensor für Schlag, Schock, Überdruck
- Störmeldung des Batteriemanagementsystems
- Überwachung einer möglichen Tiefenentladung
- visuelle Kontrolle
- Wärmebild
„Batteriefachkundige“ geben Richtung vor
Sicherheitskritische Batteriesysteme müssen zeitnah einer technischen Bewertung durch Batteriefachkundige (gemäß DGUV Information 209-093 „Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen“, Stufe 3E/3S) unterzogen werden.
Erst wenn ein Batteriefachkundiger seine Freigabe erteilt hat, dürfen die Batteriesysteme bewegt und auf eine gesicherte Ruhefläche gestellt werden. Der von den Batteriefachkundigen festgelegte Zeitraum für das Abstellen auf der gesicherten Ruhefläche ist abhängig vom Schaden. Im Fall eines mechanisch beschädigten Moduls müssen die Herstellerangaben zu Ruhezeiten beachtet werden. Ist die Ruhezeit abgelaufen, bedarf es einer erneuten Beurteilung durch einen Batteriefachkundigen, die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Berücksichtigung finden muss.
Schutz gesicherter Ruheflächen für kritische Batterien
Der Zustand kritischer Batterien ist zu dokumentieren und Maßnahmen sind schriftlich zu fixieren. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden geschulte Batteriefachkundige benötigt. Kritische Batteriesysteme sollten im Freien auf einer gesicherten Ruhefläche gelagert werden. Im Zuge der Einrichtung gesicherter Ruheflächen muss auf die Exposition der Umgebung geachtet werden. Gesicherte Ruheflächen können vor allem durch folgende Maßnahmen geschützt werden, um die bestehenden Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorgaben zu erfüllen:
- Auffangwanne für auslaufende Gefahrstoffe
- Gasmanagementsystem, Überdruckausgleich
- Kein Zutritt für Unbefugte!
- Mindestabstände zu Bebauungen müssen gemäß der Musterbauordnung, umgesetzt in der entsprechenden Landesbauordnung oder Muster-Industriebau-Richtlinie, mit der Baugenehmigungsbehörde abgestimmt werden.
- Sicherheitsbehälter
- Witterungsschutz
Die Batteriefachkundigen unterziehen die Batterie nach einem selbst definierten Zeitraum einer erneuten Überprüfung und geben im Anschluss weitere Schritte vor.




















Kommentare
Einen Kommentar schreiben