Umgang mit und Wartung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen in Rechenzentren
- Kommentare: 0
- Sicher arbeiten
- Artikel als PDF herunterladen

Lithium-Ionen-Technologie ersetzt zunehmend klassische VRLA-Batterien in Rechenzentren – mit Vorteilen wie höherer Energiedichte, geringerer Wartung und längerer Lebensdauer. Für Elektrofachkräfte ergeben sich neue Anforderungen an Planung, Betrieb und Sicherheit, die fundiertes Fachwissen und normgerechtes Arbeiten voraussetzen.
Über Jahrzehnte hinweg waren ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien (VRLA) die dominante Energiespeicherlösung für unterbrechungsfreie Stromversorgungen in Rechenzentren. Ihre Technik ist ausgereift, die Handhabung bekannt, doch die Nachteile sind gravierend. Das hohe Gewicht erfordert oftmals verstärkte Tragkonstruktionen, der große Platzbedarf verringert die Effizienz der Flächennutzung und die ausgeprägte Temperaturabhängigkeit erhöht die Anforderungen an die Klimatisierung. Hinzu kommen eine relativ kurze Lebensdauer von drei bis sechs Jahren und ein hoher Wartungsaufwand, der sowohl Arbeitszeit als auch Ersatzteilkosten umfasst.
Mit den Fortschritten der Lithium-Ionen-Technologie, insbesondere durch den Massenmarkt Elektromobilität, hat sich diese Ausgangslage verändert. Lithium-Ionen-Batterien bieten eine bis zu dreimal höhere Energiedichte (Wh/kg) und eine deutlich höhere Ausgangsleistungsdichte (W/kg). In der Praxis bedeutet dies, dass bei gleicher Leistung bis zu 80 Prozent weniger Gewicht und bis zu 50–80 Prozent weniger Stellfläche benötigt werden. Diese Faktoren wirken sich besonders in Ballungszentren aus, wo Flächenkosten hoch sind und jede Quadratmeteroptimierung direkte wirtschaftliche Effekte erzielt. Für bestehende Rechenzentren ermöglicht dies die Erhöhung der USV-Leistung im vorhandenen Raum, für Neubauten eine kompaktere Bauweise.
Am Ende dieses Fachtextes steht eine praxisorientierte Checkliste, die speziell auf den sicheren und normgerechten Umgang mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen in Rechenzentren zugeschnitten ist. Sie bündelt alle relevanten Prüf- und Wartungspunkte in einer strukturierten Form, erleichtert die systematische Kontrolle der Anlage und stellt sicher, dass keine sicherheitsrelevanten Schritte übersehen werden. Elektrofachkräfte können die Liste als Arbeits- und Dokumentationsgrundlage nutzen, um Inspektionen effizient durchzuführen, Wartungsmaßnahmen lückenlos nachzuweisen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben jederzeit belegen zu können.
Leistungsdaten, Zyklenfestigkeit und Alterungsverhalten
Moderne Lithium-Ionen-Batterien erreichen Lebensdauern von zehn bis 15 Jahren, in Abhängigkeit von Zellchemie, Temperaturführung und Lastprofil. Das ist mehr als doppelt so lange wie bei VRLA-Systemen. Die Zyklenfestigkeit liegt bei optimaler Betriebsführung bei bis zu 5.000 Lade- und Entladezyklen. Damit lassen sich bei gleicher Betriebszeit deutlich weniger Austauschzyklen realisieren, was die Gesamtbetriebskosten senkt.
Charakteristisch ist der nahezu lineare Kapazitätsverlust über die gesamte Lebensdauer. Das bedeutet, dass die Leistung eines Lithium-Ionen-Systems planbar und konstant abnimmt, ohne den abrupten Einbruch wie bei VRLA, die ab einer Restkapazität von etwa 80 Prozent schnell an Leistungsfähigkeit verlieren. Für die Betriebsplanung im Rechenzentrum ist dieser vorhersehbare Verlauf ein wesentlicher Vorteil, da er den Austauschzeitpunkt exakt planbar macht. Zudem liegt der Innenwiderstand von Lithium-Ionen-Batterien niedriger, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung führt. In der Folge sinkt der Energieaufwand für die Klimatisierung und die thermische Belastung der Batterien selbst wird reduziert – ein Faktor, der die Lebensdauer zusätzlich verlängert.
Tipp der Redaktion
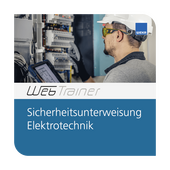
Sicherheitsunterweisung Elektrotechnik
- Erst- und Wiederholungsunterweisung für Elektrofachkräfte
- Modern und ohne Aufwand schulen
- Für die Elektrosicherheit in Ihrem Betrieb nach DGUV- und VDE-Vorschriften
Chemische Varianten und sicherheitsrelevante Unterschiede
In Rechenzentren kommen vor allem Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid (NMC) und Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO₄) zum Einsatz. NMC bietet hohe Energiedichte und wird bevorzugt, wenn auf engem Raum maximale Leistung erforderlich ist. LiFePO₄ zeichnet sich durch höhere thermische Stabilität und ein geringeres Risiko unkontrollierter Sauerstofffreisetzung im Fehlerfall aus. Diese Eigenschaften machen LiFePO₄ besonders attraktiv, wenn der Brandschutz im Vordergrund steht. Die Wahl der Zellchemie sollte daher stets unter Berücksichtigung der Prioritäten im jeweiligen Rechenzentrum erfolgen: maximale Leistung auf engem Raum oder höchstmögliche Sicherheit bei erhöhter thermischer Belastung.
Temperaturführung und Kühloptimierung
Die optimale Betriebstemperatur für Lithium-Ionen-Systeme liegt im Bereich von 20 bis 25 °C. Dieser Bereich sorgt für maximale Lebensdauer und stabile Leistungsabgabe. Im Gegensatz zu VRLA-Batterien, die schon bei leichten Abweichungen deutliche Alterungserscheinungen zeigen, tolerieren Lithium-Ionen-Systeme auch höhere Temperaturen über längere Zeiträume ohne gravierende Leistungseinbußen. Das erlaubt eine Reduzierung der Kühllast im Rechenzentrum, was unmittelbar zu einer Senkung des Energieverbrauchs führt.
Da der zulässige Temperaturbereich für USV-Elektronik und Lithium-Ionen-Batterien identisch ist, können beide im selben Raum betrieben werden. Das vereinfacht die Bauplanung und reduziert Installationskosten. Gleichzeitig bleibt die Klimatisierung planbarer, da Wärmespitzen durch die geringere Wärmeentwicklung beim Laden und Entladen minimiert werden. Dieser Vorteil wird in der Praxis oft unterschätzt, kann aber im Jahresbetrieb deutliche Kosteneinsparungen bewirken.
Batteriemanagementsysteme und Monitoring-Integration
Das Batteriemanagementsystem (BMS) ist das sicherheitstechnische Herzstück moderner Lithium-Ionen-Batterieanlagen. Es überwacht kontinuierlich Spannung, Strom und Temperatur jeder einzelnen Zelle oder jedes Moduls und steuert Lade- und Entladevorgänge so, dass keine kritischen Zustände entstehen. Bei Abweichungen, etwa Übertemperatur, Überladung oder Unterspannung, greift das BMS sofort ein, begrenzt die Leistung oder trennt betroffene Module vom System.
In großen Rechenzentren ist das BMS oft über standardisierte Schnittstellen in das Data Center Infrastructure Management (DCIM) integriert. Dadurch können alle relevanten Betriebsparameter zentral erfasst und analysiert werden. Diese Integration ermöglicht vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), bei der mögliche Ausfälle frühzeitig erkannt und gezielt verhindert werden.
Hot-Swapping und Betriebssicherheit
Ein bedeutender Vorteil moderner Lithium-Ionen-Systeme ist die Möglichkeit des Hot-Swappings. Defekte Module oder einzelne Zellen lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, ohne dass die gesamte USV-Anlage abgeschaltet werden muss. Das minimiert Ausfallzeiten und erhöht die Betriebssicherheit.
Im Gegensatz dazu ist bei VRLA-Systemen häufig der Austausch eines gesamten Strangs erforderlich, selbst wenn nur ein Block defekt ist. Das verursacht höhere Kosten und längere Wartungsfenster. Durch die modulare Bauweise der Lithium-Ionen-Systeme können Ersatzteile gezielt bevorratet werden, was die Instandhaltung beschleunigt.
Downloadtipps der Redaktion
E-Book: Erstprüfungen nach DIN VDE 0100-600:2017-06
Hier gelangen Sie zum Download.
Checkliste: Prüfung der elektrischen Maschinenausrüstung – Einbauräume
Hier gelangen Sie zum Download.
Sichtprüfung von Maschinen nach VDE 0113-1 (Wiederholungsprüfung)
Brandschutz und DGUV-Vorgaben
Die DGUV Information 205-041 stellt für den Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien klare Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz. Sie beschreibt mechanische Beschädigung, thermische Einflüsse und unsachgemäßes Laden als Hauptursachen für Brandereignisse. Besonders kritisch ist das thermische Durchgehen (Thermal Runaway), bei dem sich die Batterie durch eine Kettenreaktion selbst erhitzt und in Brand geraten kann.
Empfohlen werden bauliche Maßnahmen wie separate, feuerbeständige Lagerräume, rauchdichte und selbstschließende Türen sowie die klare Trennung von Brandabschnitten. Bei größeren Beständen von Lithium-Ionen-Batterien ist eine getrennte Lagerung innerhalb eines Lagerabschnitts sinnvoll, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Als Löschmittel gelten wasserbasierte Lösungen mit hohem Kühleffekt als am wirksamsten.
Lagerung, Gefährdungsbeurteilung und Sanierung
Die DGUV empfiehlt, jede Anlage mit Lithium-Ionen-Batterien einer Gefährdungsbeurteilung zu unterziehen, die alle Einflussfaktoren berücksichtigt: Ladehistorie, mechanische Belastung, Alter, Umgebungsbedingungen und geplante Einsatzdauer. Diese Beurteilung sollte regelmäßig aktualisiert werden, um neue Risiken frühzeitig zu erkennen.
Nach einem Brandereignis oder einer Havarie müssen betroffene Bereiche sorgfältig saniert werden. Dazu gehören die fachgerechte Entsorgung von kontaminierten Materialien als Gefahrgut, die Reinigung betroffener Flächen und die Kontrolle der Raumluft auf schädliche Partikel oder Gase.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Normen
Neben der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU gelten die Batterieverordnung (EU) 2023/1542 mit Vorgaben zu Rücknahme, Recyclingquoten und Kennzeichnungspflichten sowie REACH- und RoHS-Bestimmungen zu Materialeinsatz und Schadstoffgrenzen. Internationale Normen wie IEC 62619 und IEC 62620 legen Sicherheits- und Leistungsprüfungen fest, die für den Betrieb im Rechenzentrum relevant sind. Für den Transport greifen die ADR-Gefahrgutvorschriften, ergänzt durch spezielle Anforderungen für Luft- und Seefracht.
Hersteller sind verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen. Betreiber sollten frühzeitig vertragliche Vereinbarungen mit Lieferanten treffen, um den Ablauf der Rückführung zu sichern. Neben der Rücknahmepflicht ist eine lückenlose Dokumentation der Batteriedaten erforderlich, um Materialströme transparent zu halten.
Zukunftsaussichten und Marktentwicklung
Prognosen wie die von Bloomberg New Energy Finance gehen davon aus, dass Lithium-Ionen-Systeme bis 2025 rund 40 Prozent des USV-Markts in Rechenzentren ausmachen werden. Fortschritte in der Zellchemie, etwa durch verbesserte Kathodenmaterialien oder optimierte Elektrolyte, werden Sicherheit, Energiedichte und Ladeeffizienz weiter erhöhen. Parallel dazu werden Brandschutzkonzepte und Recyclingverfahren standardisiert, was die Technologie noch attraktiver macht.
Praxis-Checkliste für Elektrofachkräfte: Lithium-Ionen-Batteriesysteme in Rechenzentren
(basierend auf DGUV Information 205-041, relevanten EU-Richtlinien, Normen und Herstellerempfehlungen)
1. Planung und Installation
- vor der Installation Gefährdungsbeurteilung durchführen, inklusive Analyse der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, mechanische Belastungen)
- Auswahl der geeigneten Zellchemie (NMC oder LiFePO₄) abhängig von Prioritäten wie Platzbedarf, Energiedichte oder Brandschutz
- mechanische Integration mit vibrations- und stoßgesicherter Befestigung
- sicherstellen, dass Raumtraglast und Stellfläche für Gewicht und Größe der Batterie ausgelegt sind
- Brandschutzkonzept anlagenspezifisch festlegen, inklusive baulicher Brandabschnitte und Löschtechnik
2. Inbetriebnahme
- Funktionstest des Batteriemanagementsystems (BMS), inklusive Überprüfung der Sensoren für Spannung, Strom und Temperatur
- Anbindung des BMS an das Data Center Infrastructure Management (DCIM) oder ein vergleichbares Überwachungssystem
- Lade- und Entladeparameter gemäß Herstellervorgaben einstellen und dokumentieren
- Schutzfunktionen gegen Überladung, Tiefentladung und Übertemperatur aktivieren und auf Wirksamkeit prüfen
- erste Ladung unter Überwachung durchführen, um Systemstabilität zu bestätigen
3. Betrieb
- permanente Überwachung von Temperatur, Ladezustand, Zellspannung und Stromfluss über das BMS
- monatliche Kontrolle auf physische Schäden, Undichtigkeiten oder Verfärbungen an Modulen und Gehäusen
- sicherstellen, dass Temperaturbereich 20–25 °C eingehalten wird; Abweichungen dokumentieren und Ursachen analysieren
- Alarmmeldungen aus dem BMS sofort bewerten und Ursachen vor Ort verifizieren
- Ladekennlinie regelmäßig prüfen und bei Firmware-Updates des USV-Systems anpassen
4. Wartung
- jährliche Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Funktionen des BMS
- Hot-Swap-Austausch defekter Module ausschließlich nach Herstelleranweisung und unter Lastabsicherung durchführen
- Lüftungsschlitze, Kühlkanäle und Raumklimatisierung auf Funktion und freie Strömung prüfen
- Dokumentation aller Austausch- und Reparaturmaßnahmen, inklusive Seriennummern und Betriebsstunden
- Schulung des Wartungspersonals zu aktuellen Sicherheits- und Brandschutzvorgaben
5. Brandschutz und Lagerung
- Lithium-Ionen-Batterien ausschließlich in separaten, feuerbeständigen Räumen oder abgeschotteten Bereichen lagern
- rauchdichte, selbstschließende Türen mit Feuerwiderstandsklasse gemäß Brandschutzkonzept verwenden
- getrennte Lagerung innerhalb eines Lagerabschnitts bei größeren Mengen, um Brandübertragung zu vermeiden
- geeignete Löschmittel mit hohem Kühleffekt (Wasser mit Zusätzen) bereitstellen
- Lagerbedingungen regelmäßig auf Temperatur und Luftfeuchte überwachen
6. Störfallmanagement
- Vorgehensplan für den Fall eines thermischen Durchgehens (Thermal Runaway) erstellen und im Team einüben
- Brandschutzbeauftragte und interne Notfallteams in Löschverfahren für Lithium-Ionen-Batterien unterweisen
- bei Rauchentwicklung oder Geruchsentwicklung sofortige Trennung des betroffenen Moduls vom System veranlassen
- nach Brandereignis oder Havarie kontaminierte Bereiche und Batterien als Gefahrgut entsorgen
- Raumluft nach Brandereignis auf gefährliche Partikel und Gase prüfen
7. End-of-Life und Recycling
- Rücknahmevereinbarungen mit dem Hersteller/Lieferanten schriftlich fixieren
- Transport ausschließlich nach ADR-Vorgaben für Gefahrgut organisieren
- vollständige Dokumentation der Batteriedaten für Entsorgungs- und Recyclingprozess bereitstellen
- Prüfung, ob aktuelle Recyclingverfahren für Zellchemie verfügbar sind, um frühzeitig den geeigneten Entsorger auszuwählen
8. Dokumentation und Compliance
- alle Prüf- und Wartungsberichte, Gefährdungsbeurteilungen, Temperaturprotokolle und Austauschmaßnahmen archivieren
- regelmäßige Überprüfung der Anlage auf Konformität mit Batterieverordnung (EU) 2023/1542, Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, REACH und RoHS
- Updates der Normen IEC 62619 und IEC 62620 im Wartungskonzept berücksichtigen




















Kommentare
Einen Kommentar schreiben